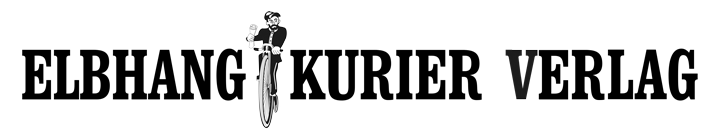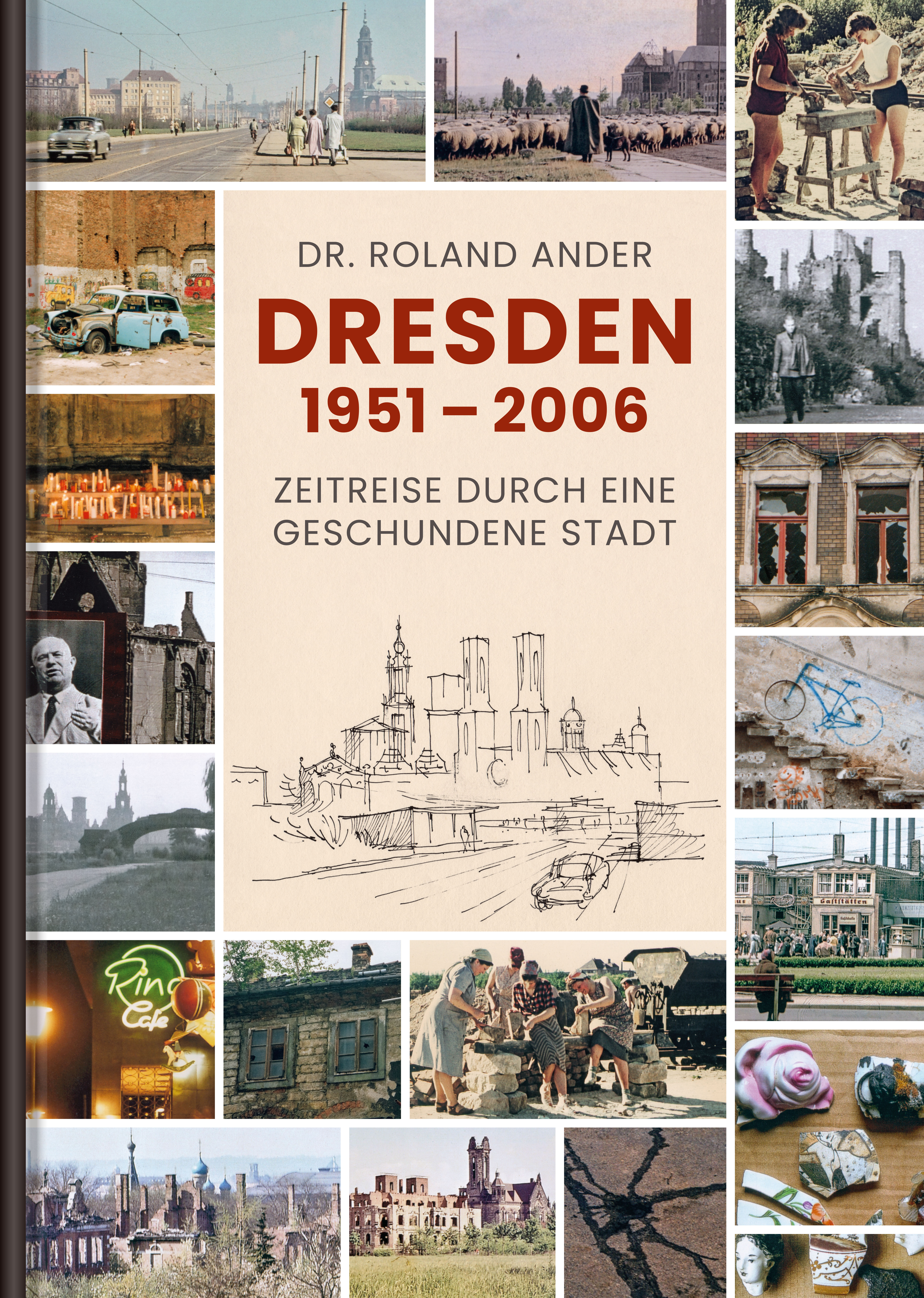Im Interview mit dem Elbhang-Kurier äußert sich Uwe Tellkamp, Autor des erfolgreichen Romans „Der Turm“, über Vergangenes, Gegenwärtiges und Künftiges
Bei seiner Lesung unlängst in Dresden sprach der Autor Uwe Tellkamp davon, dass er in der am Küchentisch im fernen Freiburg im Breisgau entworfenen Ortsskizze zu seinem Roman „Der Turm“ den ELBISCHEN FLUSS quasi auf die Höhe der Grundstraße verlegt habe. Wer daraufhin die kommentierte „Landkarte“ in seinem Buch im „Maßstab 1:1001“ als launige Draufsicht auf die Geburtsstadt noch einmal eingehend studiert, erlebt wahrhaft viele Irritationen. Und entdeckt auch den markanten „Elbeinschnitt“ – irgendwo zwischen Standseilbahn und Schwebebahn.
Zeichnerisch wie literarisch ist deutlich der Elbhang anvisiert – ein mit Genuss ausgekosteter Spielraum von Dichtung und Wahrheit, wo sich Bekanntes, Unbekanntes, Vergessenes, Verwandeltes, Ersonnenes miteinander verquicken. Keine Frage: Uwe Tellkamp und seine mit dem Deutschen Buchpreis gekrönte „Geschichte aus einem versunkenen Land“ sind vehement ins Blickfeld vom ELBHANG-KURIER gerückt, den die Familie übrigens in Freiburg bezieht. Und so hat sich auf der Basis gemeinsamer Vorlieben erfreulicherweise die Möglichkeit für ein Interview ergeben, und dieses soll nachfolgend vorgestellt werden.

Uwe Tellkamp 2008 in Dresden.
Foto: Gabriele Gorgas
Elbhang-Kurier: Rundum im Lande und besonders natürlich auch in Dresden wird gerätselt, wer sich hinter Ihren literarischen Gestalten verbirgt. Sind Sie verblüfft oder amüsiert, so beim Wort genommen zu werden?
Uwe Tellkamp: Meine Figuren haben Vorbilder, aber man kann sie nicht eins zu eins auf ein Vorbild beziehen. Meist sind Figuren, so auch meine, zusammengesetzt, übernehmen Eigenarten vom Vorbild A, Biographisches vom Vorbild B, Äußerlichkeiten vom Vorbild C. Lebendige Romanfiguren (solche, die lebendig in der Vorstellung des Lesers wirken) entwickeln sehr bald ein Eigenleben, das sie von allem bloß Übernommenen entfernt. Natürlich wird jeder Dresdner Leser wissen, dass das Institut meines Barons von Arbogast gewisse Ähnlichkeiten mit dem Institut von Ardenne hat. Arbogast aber ist ein Höllenbote, womöglich ein schwarzer Zauberer – und spätestens dort dürften die Parallelen enden. Überhaupt ist mein Buch nur unter Vorbehalt als sogenannter realistischer Roman zu lesen, Märchenhaftes und Phantastisches – E.T.A. Hoffmann ist ein heimlicher Pate hinter den Kulissen – überwuchern die Szenerie. Wofür ich gute Gründe hatte, denn die DDR und das Dresden der achtziger Jahre, in dem die Uhren schlugen, die Zeit aber stillstand, wo die Elbe vergiftet um die Zimmer kreiste und ihr Totenwachs ablagerte, wo die Eisblumen über Türen und Treppen krochen, war ein Märchengebiet in einer Märchenzeit.
Was treibt einen Autor, ein so voluminöses Buch zu schreiben? Fürchten Sie nicht „Schwellenängste“ bei Ihren Lesern? Und was bewegt Sie besonders in Ihren Gesprächen an so unterschiedlichen Orten?
Thomas Mann, mit dem mich viel verbindet, sagt sinngemäß, nur das Gründliche sei wahrhaft unterhaltsam. Es ist die Fülle der Geschichten, der Reichtum an Erfahrungen, der das Buch an Umfang und, ich denke doch, auch an Inhalt reich gemacht hat. Es ist kein aufgeblasenes oder vollgestopftes Buch, sondern alle seine Kapitel und alle seine Beschreibungen sind wohlerwogen, haben ihren Sinn. Ich schreibe nicht einfach so daher, übrigens muss man schon dem Lektorat und den Verlags-Vertretern recht gut Rede und Antwort stehen können, ehe ein Buch, ein umfangreiches zumal, gedruckt wird. Motive, die unter der eigentlichen Handlung weben, verlangen nach Ausarbeitung, Figuren entwickeln sich und müssen, will man als Autor überzeugend schreiben, in ihrer Entwicklung plausibel gestaltet werden. All das braucht erzählerischen Raum.
Dennoch: In einem guten Buch, wie ich es verstehe, darf nichts überflüssig sein. Und auch, wenn das hier und dort gedacht wird: Im »Turm« ist nichts überflüssig. Was Ihre Frage nach den Schwellenängsten betrifft: Mag sein, dass ein dickes Buch zunächst einen potentiellen Leser abschreckt, doch auch in einem dünnen Buch muss man die erste Seite aufschlagen, wenn man es lesen will. Ist das Buch gut, fesselt es den Leser, gleichgültig, ob dünn oder dick, er will weiterlesen. Liefert das Buch eine Welt mit ihren Sinneseindrücken, ihren Details und Geschichten, will er sie bewohnen und wird traurig sein, wenn das Buch zu Ende ist. Ich bekomme derzeit viele Briefe von Lesern des »Turms«, denen die knapp 1000 Seiten nicht genügen, sie fragen nach einer Fortsetzung, wollen wissen, wie es mit Christian, Richard, Meno und Anne weitergeht.

Oskar-Pletsch-Straße 10 – Vorbild für das „Haus Abendstern“.
Foto: Archiv Uwe Tellkamp
Es gibt in Ihrem Roman einiges, was Sie spürbar geradezu magisch anzieht, und dazu gehören beispielsweise auch Schallplatten als Metaphern des dinglichen Seins. Offenbar reizt Sie die Magie der Dinge?
Die Magie der Dinge ist eine Magie der Menschen, die sie mir nahebrachten und die ich damit verbinde. Es ist mir unvergesslich, wie mich mein Onkel nach der Schule nach oben rief und mir verschiedene Aufnahmen eines Musikstücks vorspielte; ich erinnere mich besonders an »Tannhäuser« unter Fritz Busch, Rudolf Kempe, Artur Rother und Hans Knappertsbusch, an die »Don Giovanni«-Aufnahmen unter Karl Elmendorff (die vielleicht die schönste überhaupt ist, leider scheint Elmendorff, obwohl ehemals Dresdner Dirigent, fast vergessen), Wilhelm Furtwängler und Karl Böhm. Viele Musiker lebten und leben auf dem Weißen Hirsch, sommers hörte man bei offenen Fenstern nahezu auf jeder Straße Musik. Schallplatten, vor allem die der Deutschen Grammophon, die – schwarze Scheibe und gelbes Etikett – die Wappenfarben Dresdens aufnahm, von Eterna und Melodia haben meine Kindheit geprägt und sind, als Symbol, für mein Autorenleben wichtig geworden, denn eine Schallplatte ist auch ein Doppel-Labyrinth (die fortkreisende Rille auf A- und B-Seite), das berührt das innerste Motiv meines Schreibens.

Die 1. Klasse in der 102. Oberschule in Johannstadt.
Foto: Archiv Uwe Tellkamp
Die Beschreibung von Ostrom irritiert trotz allem Wissen um Dichtung und Wahrheit gewiss jeden, der nach einem Areal in dieser Verquickung in unmittelbarer „Hirschnähe“ sucht.
Jedes Buch entwirft, wenn es eine Welt zu erfassen versucht, auch ein Modell dieser Welt, und das tut auch mein Roman »Der Turm«. »Die Kohleninsel«, wie ein Kapitel überschrieben ist, in dem es um einen finsteren Behördenbezirk in eben jenem fiktiven Viertel »Ostrom« geht, wird man im realen Dresden nicht finden, dennoch aber wird der sozialismuserfahrene Leser dieser Vision Wahrhaftigkeit nicht absprechen können. Obwohl sie eine Vorstellung widerspiegeln, halte ich die Kohleninseln des Sozialismus für überaus real. Sie sind eine Zusammenfassung dessen, was wir uns vorstellen, wenn wir Gelbes Elend/Bautzen, Staatssicherheit, Behördenwillkür, Moskauer Lubjanka, Akten und Verwaltungsapparat denken.
Dresden und speziell der Weiße Hirsch ist der Ort Ihrer Kindheit und Jugend. Könnten Sie sich auch vorstellen, wieder in Dresden zu leben und zu arbeiten? Oder brauchen Sie die Distanz, um sich die Draufsicht zu bewahren, schärfer sehen zu können?
Meine Frau und ich können es uns nicht nur vorstellen, wir möchten es auch sehr gerne. Nur ist meine Frau beruflich in Freiburg, wo wir jetzt leben, gebunden. Der künstlerischen Arbeit kann Distanz ja durchaus förderlich sein, aber ich kann auch in Dresden Distanz zu Dresden haben, zumal sich die Stadt entwickelt und verändert. Denn was ist Dresden? Im Grunde die Vorstellung eines jeden, der darüber spricht. Es gibt kein Dresden, das für alle gleichermaßen verbindlich ist. Ein Ingenieur wird die Stadt anders sehen als ein Musiker. Dresden wird gerne als Musikstadt, Stichwort Staatskapelle und Semperoper, wahrgenommen; aber mindestens so sehr wie Musikstadt war Dresden auch eine Stadt der Pharmazie, der Kinos (manche sprechen von der »Welthauptstadt der Kinematographie«!), der Nahrungs- und Genussmittelindustrie, der Näh- und später der Schreibmaschinen; Dresden war eine Hauptstadt der Zauberkunst: Der kürzlich verstorbene Manfred Scholtyssek leitete die Zauberkunstzirkel der DDR – und wohnte auf dem Weißen Hirsch meiner Familie gegenüber.
Dresden als Ort meiner Kindheit und Jugend: Ich nenne es das Universum der vergangenen Augenblicke, und dieser Bezirk beschäftigt wohl jeden Autor immer wieder. Hier habe ich die Original-Eindrücke erlebt – wenn ich »Fluss« denke, denke ich an die teerschwarze Elbe meiner Kindheit und nicht etwa an den Rhein oder die Donau. Ich höre das Geräusch der Kohlenschippen aus der Kohlenhandlung am Rißweg, oben auf dem Weißen Hirsch, einst Höhen-Radbahn des Lahmannschen Sanatoriums. Ich sehe den leeren, in die Tasche genähten Ärmel des Mathematiklehrers und Kriegsheimkehrers Oskar Schirrmacher vor mir, erinnere mich, wie ich zum ersten Mal das Wort Bomätscher hörte. Erinnere mich an das erste selbstverdiente Geld, ein 50-Pfennig-Stück, das ich von einer alten Frau fürs Kohlenschleppen bekam, die noch Hofdame am letzten sächsischen Königshof gewesen war. Erinnere mich an die Leidenschaft in den Gesprächen im Familienkreis, wenn es um den (sozialistischen) Alltag und die politischen Verhältnisse ging, an die ebenso nostalgische und besessene wie problematische Liebe derer, die ich die »Türmer« nenne, zu Dresden, zur Musik und ihren Namen.

Oktober 1972, auf der neuen Prager Straße.
Foto: Archiv Uwe Tellkamp
In Ihrer launigen Ortsskizze verlegen Sie den Elbischen Fluss etwa auf die Höhe der Grundstraße. Würden Sie auch gern den aktuellen Brückenbau irgendwohin in die Wildnis verbannen?
Für den Brückenbau hat eine Mehrheit der Dresdner Bürger gestimmt, das sollte man in einer demokratischen Gesellschaft respektieren. Ob das für die nun geplante Brücke geschah, ist eine andere, gesondert zu betrachtende Frage. Auch ich bin ursprünglich ein Brückengegner gewesen, habe mich aber einmal morgens, bei einem Fototermin, aufs Blaue Wunder gestellt. Über die Brücke ging ein geradezu unendlicher Verkehr, wie Kafka im »Urteil« schreibt. Und was geschieht, wenn das Blaue Wunder einmal saniert werden muss? Das könnte bald der Fall sein müssen. Ich glaube, dass es eine neue Elbquerung braucht – ob nun Brücke oder Tunnel, darüber lässt sich trefflich streiten. Übrigens, so habe ich mir von einem Ingenieur sagen lassen, war an der Stelle, wo man jetzt die Waldschlößchenbrücke baut, schon früher eine Querung geplant. Das Kollwitz-Ufer macht auf dieser Höhe einen straßentechnisch nicht anders begründbaren Knick.
Wie erleben Sie heute Orte und Leute Ihrer Geschichte aus einem versunkenen Land?
Alles hat sich verändert, und nicht immer zum Guten. Meine Generation, zum Teil auch die meiner Eltern, hat es in alle Winde verstreut, man folgte den Arbeitsplätzen. Die in Dresden wie überhaupt im Osten zunächst einmal wegfielen, weil der Sozialismus das Land heruntergewirtschaftet hat, das möchte ich gegen alle Ostalgie, die viel vergisst, deutlich klarstellen. Dresden ist keine wirklich große Stadt, aber es beginnt sich, so scheint es mir, allmählich von den Wunden der Vergangenheit zu erholen. Und es ist und bleibt meine Heimat, zu der ich eine zwar kritische, aber leidenschaftliche Liebe hege. Es mag pathetisch klingen, aber wenn ich Lesungen habe, bin ich auch eine Art Botschafter, verteidige die Stadt und die – das wird man feststellen, wenn man herumkommt –, sehr seltene und liebenswürdige Eigenart ihrer Bewohner.

Uwe Tellkamp in NVA-Uniform im März 1988.
Foto: Archiv Uwe Tellkamp
Sie sind ein bekennender Leser vom Elbhang-Kurier. Ist das für Sie so eine Art Regenbogen aus der Heimat? Und sind Sie als gebürtiger Dresdner in Ihrer Familiengeschichte in Sachsen verwurzelt, haben Sie neben Freunden und Bekannten auch noch Verwandte in der Stadt?
Der Elbhang-Kurier informiert mich detailliert und ausgiebig über die Geschehnisse im Biotop des Elbhangs, aus dem ich stamme. Er ist also so etwas wie ein Fernrohr für mich, durch das ich, gewissermaßen, schauen kann, wenn ich ihn lese. Und da ich noch viele Verwandte, Freunde und Bekannte in Dresden habe, bin ich gern auf dem laufenden. Auch lese ich mit großer Anteilnahme die Geschichten über Menschen aus meiner Heimat, so z. B. die schöne Reportage Sonja Bernstengels über die »Straße der Öfen« an der Grundstraße oder die über Leonhardis Tintenfabrik. Die Tellkamps kommen ursprünglich aus Hamburg, erst mein Urgroßvater ist die Elbe ein wenig aufwärtsgewandert.
Ihr konsequenter Zeiteinschnitt 1989 lässt vermuten, dass Sie vom „Turm“ aus auch noch die endlose Weite betrachten werden. Sie sprechen von einer literarischen Großbaustelle. Womit können wir in den nächsten Jahren rechnen?
Zunächst möchte ich einige »kleinere« Bücher veröffentlichen, eins davon über das Leben mit meinem Sohn Meno Nikolaus, der zwei Jahre alt ist. Es soll »Der Zitronenrabe« heißen und ganz im Hier und Heute spielen. Auch plane ich die Fortsetzung des »Turm«-Stoffs und die Weiterarbeit an einem alten Projekt namens »Der Nautilus«, einer Dichtung, die tief in die Vergangenheit des 20. Jahrhunderts forscht. Lassen Sie sich überraschen.
Das Gespräch führte Gabriele Gorgas