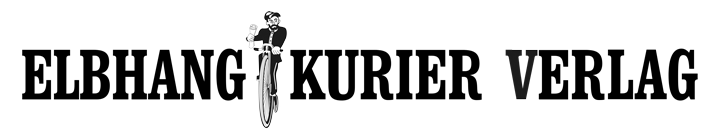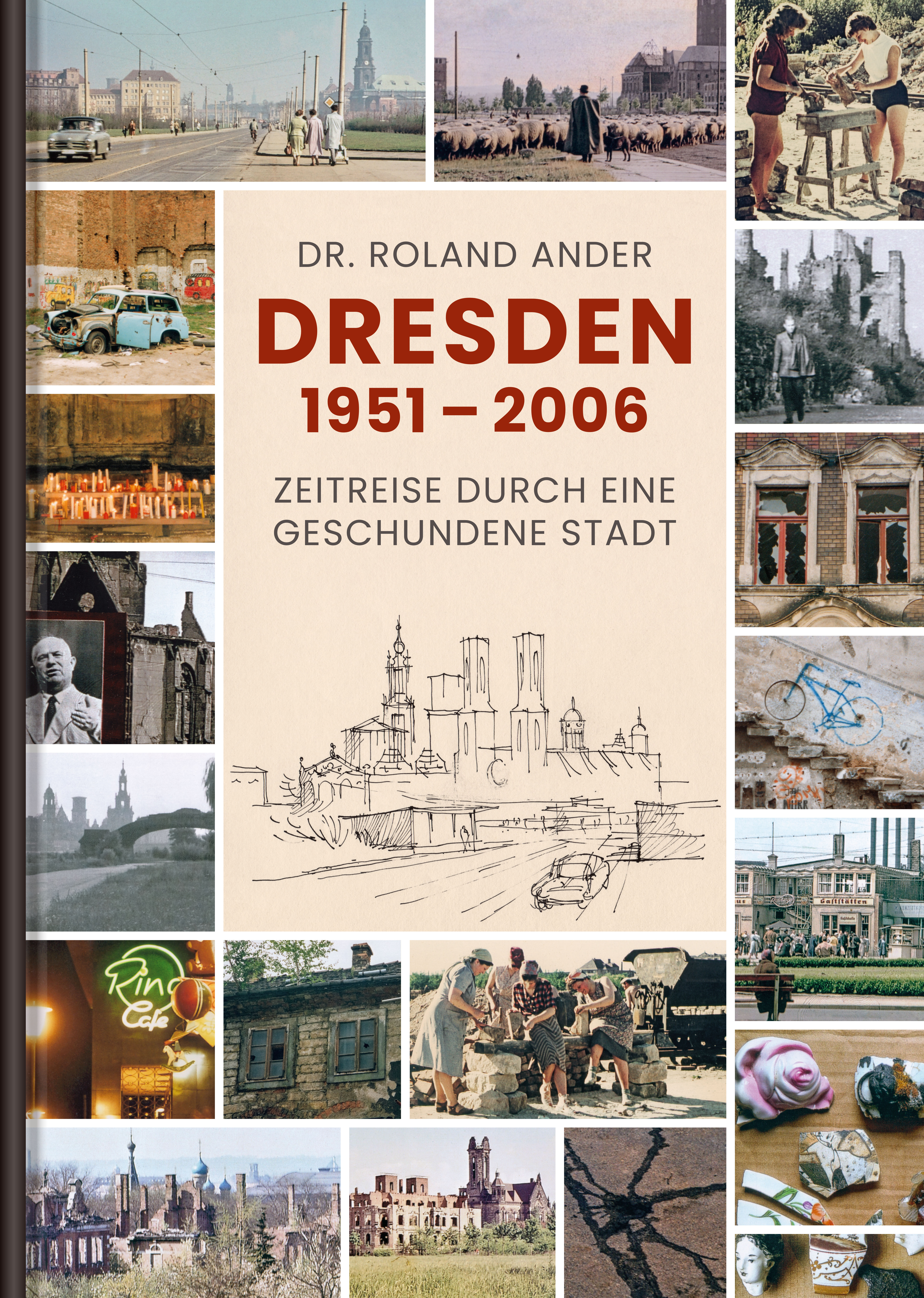Als Dresden noch keine „Welterbestadt“ war – Erinnerung an einen privaten Kunstsammler aus Bühlau
Ende Mai stellte Professor Dr. Werner Schmidt Mitarbeitern und Freunden der Elbhang-Kurier-Redaktion Teile seiner Graphik-Sammlung („Von Picasso bis Penck“) vor, die er – gemeinsam mit seiner Frau Isolde – dem Stadtmuseum Pirna zum Geschenk gemacht hat. Mit diesem Vermächtnis reiht sich Professor Schmidt in die große Dresdner Privatsammler-Tradition ein, zu deren Anfängen auch das gegenwärtig zu bewundernde „Carus-Album“ (siehe Elbhang-Kurier 6/2009) gehört. Unsere aus Bühlau (Gründelsteig) stammende, jetzt in Detmold lebende Leserin Annette Dziggel geborene Schulze machte uns gleichfalls auf die im 20. Jahrhundert entstandene Dresdner Grafiksammlung ihres Vaters Dr. Siegfried Schulze (1916 – 1987, langjähriger Mediziner im Dresdner Serumwerk bis 1972) aufmerksam, die erst- und letztmalig unter dem Titel „KUNST AUS DRESDEN“ im Herbst 1981 im Kunstkabinett Kempten (Allgäu), wohin sie „gerettet“ worden war, gezeigt werden konnte. Überliefert ist die Rede zur Eröffnung der damaligen Ausstellung, gehalten von dem dortigen Dresden-Kenner Alfred Hoentzsch, der die in Dresden entstandenen und (größtenteils bei Kühl) erworbenen Schätze in einen weiten Zusammenhang stellte.
Diese vor 28 Jahren formulierte Rede, die hier in wesentlichen Auszügen folgt, könnte auch als ein lange vorweggenommener Kommentar zum „ungeheuren Dilemma“ (Staatsministerin Eva Stange) verstanden werden, das nunmehr in der degradierten Welterbestadt Dresden entstanden ist und eine vielschichtige Tradition hinterfragt.
Vorwort: Dietrich Buschbeck
Ausstellungs-Rede in Kempten 1981
„Mir war so wohl bei meinem ersten Eintritt in diese für mich ganz neue Welt von Schönheit…“ Wer sagt das? Es ist Heinrich von Kleist, er schreibt es an Wilhelmine von Zenge von Leipzig aus am 21. Mai 1801. Kleist war ja einer, und nicht der geringste, aus der Schar derer, die in Dresden das versunkene Atlantis ihrer Seele gesucht haben. Ihre Danksagungen an die Stadt kämen einer stattlichen Votivtafel gleich. Die zärtlichste Liebeserklärung spricht uns Fontane ins Ohr. Er legt sie seinem Stechlin in den Mund: „Wenn man so gar nicht mehr weiß, wohin man soll, fährt man natürlich nach Dresden.“ Eine Zuflucht also, ein Heilbad der Seele? Ja, das war es. Stendhal bezeugt es spontan: „Ich wäre glücklich, wenn ich hier leben könnt. Dresden würde mich heilen.“

Vor einer Farblithografie der Hofkirche von Otto Dix – im Kunstkabinett Kempten (v.l.n.r.): Dr. Erich Farkas, Grafiker Heinz Schubert, Sammler Dr. med. Siegfried Schulze (ehemals Dresden), Laudator Alfred Hoentzsch; 1981.
Foto: Erika Bachmann/Allgäuer Zeitung
Dresden, ein Ort der Balance
Könnte ich – Konjunktiv: deutsches Schicksal – könnte ich Sie die 41 Stufen hinaufführen zur Brühlschen Terrasse, dem Balkon Europas: Sie würden die Situation der Stadt sofort erfühlen als ein Ort der Balance, der Befriedung, in dem alle aus Nord und Süd, Ost und West ihr zuströmenden Kräfte sich vereinen zu einem Akkord. Vielleicht wäre Dresden die eigentliche Heimat gewesen für Mozart, und gewiss weiß ich nur einen, der die Seele dieser Welt anschaulich hätte überliefern können: Camille Corot – aber weder hat dieser seine Staffelei im Tal der Elbe je aufgestellt, noch können wir, wie der alte Stechlin, „natürlich“ nach Dresden fahren, in die „besondere“ Stadt, wie Klaus Bölling sie kürzlich tituliert hat.
Was uns bleibt, sind Bilder und Erinnerungen, und gottlob haben wir sie. Sehen Sie die Lithos von Otto Dix und Ernst Hassebrauk – da haben Sie das Herzstück dieser Stadt vor Augen: die Hofkirche Chiaveris mit dem grazilen Turm, dem schönsten „Salut gen Himmel”, den Theaterplatz mit der Semper-Oper, die Semper-Galerie und den Zwinger, das vollkommenste Stück Musik in der gesamten Architektur. Und vielleicht ahnen Sie, warum Dresden über drei Jahrhunderte dem Bewusstsein der zivilisierten Welt sich eingeschrieben hat als eine Stadt der Künste, als die Kunststadt, deren geschichtliche Höhepunkte ich nur markieren darf: das Augustäische Zeitalter des Barock und Rokoko, das Zeitalter der Klassik und Romantik von Winckelmann bis Caspar David Friedrich, und endlich die emphatische Revolte der „Brücke“, kurzlebig zwar, als Umsturz im geistig-seelischen Bereich spürbar bis in unsere Tage. Das Jahr 1905 war ein Rubikon und ohne die „Brücke“ gäbe es all das, was Sie hier sehen, gar nicht, oder doch: so nicht.
Nun also: Kunst aus Dresden. Ich wüsste nicht zu sagen, wie viele Ausstellungen in diesem Hause ich eröffnet habe. Ich weiß nur: diese gilt mir als die weitaus Erregendste – ich komme mir vor wie ein altes Zirkuspferd, das plötzlich die Musik hört, nach der es ein Leben lang getanzt hat. Kunst aus Dresden – das ist Grafik von Dresdner Künstlern aus den Mappen eines Sammlers, der von Beruf Arzt ist – und dies im Hause eines Arztes, der aus Passion und lebenslang ein Sammler war. Ich betone mit Nachdruck diesen Zusammenklang.
Noch ein Wort zur „Brücke“, die mit nur zwei Blättern anwesend ist: einem Heckel „Großstadt“ und einem Schmidt-Rottluff „Frauenkopf“. Die „Brücke“ war eine helle Fanfare am Beginn unseres Jahrhunderts. Kirchner, Heckel und Schmidt-Rottluff, Architektur-Studenten der Dresdener TH, anfangs der Zwanziger allesamt. Sie hatten kein Programm. Sie führten keine Polemik. Sie wollten nicht nur (wie die Präraffaeliten) hinter Raffael zurück. Weit hinter Griechenland! Sie hatten wie die „Fauves“ in Paris, im Ethnografisch-Anthropologischen Museum im Dresdner Zwinger Negermasken und Ornamentik der Südsee-Insulaner gesehen und wagten den Gang zu den Müttern. Allesamt Autodidakten (keiner hat eine Akademie gesehn), artikulierten sie Kraft der Farbe und der harten Kontur ihr Weltbild. Lautlos begann so eine neue Zeit. Unbemerkt.

Hofkirche und Semperoper Lithografie von Ernst Hassebrauk.
Foto: Erika Bachmann
„Wir sehen schweren Zeiten entgegen…”
Doch: einer hatte Witterung von dem Umschwung. Edvard Munch. „Gott steh uns bei“ , soll Munch gesagt haben, als er vor dem Ersten Weltkrieg schon Grafik von Schmidt-Rottluff sah, „Gott steh uns bei, wir gehen schweren Zeiten entgegen“. 1914 brach das „Stahlgewitter” los und eine Welt stürzte ein, und aus war es mit dem Optimismus der „Brücke“. Nur wer gestählt aus den Materialschlachten hervorging, konnte den Ruin verzeichnen. 1923 sah ich im Schaufenster der Dresdener Galerie Arnold Dix’ Gemälde „Der Schützengraben“ – eines der furchtbarsten Bilder, die je gemalt worden sind. So schrieb er den Schrecken sich von der Seele und wächst dann zu wirklicher Größe … Unsere Lithografie „Max Frisch“ und „Hegenbarth“ vermitteln wenigstens eine Ahnung seiner zupackenden Kraft. Nehmen Sie dazu noch Berganders Aquatinta-Portät „Otto Dix“ – da haben Sie den Mann, der im Ersten Weltkrieg Soldat und verwundet war, der im Zweiten Weltkrieg als Volkssturmmann noch einmal zur Waffe gezwungen als 55-jähriger auch Gefangenschaft durchstehen musste, 1933 seines Amtes als Lehrer an der Dresden Akademie enthoben wurde – er hat ein böses Stück Geschichte erwischt und er ist daran gewachsen.
Und gewachsen in Schmerz und Leid ist auch Käthe Kollwitz. Wie stolz und unnahbar trägt sie ihr „De profundis” vor, die einzige unseres Ensembels, die nie in Dresden war, aber freilich bei Dresden, in Moritzburg gestorben ist – Prinz Ernst Heinrich hat der Verfehmten – ein Fürst der Revolutionärin – diese letzte Zuflucht geboten. Hans Theo Richter ist bis zu seinem Tode im Jahre 1969 unter einer Wolke aus Schwermut gegangen, zu der sich ihm das Verhängnis der Zeit verdichtet hatte. Seine Thematik ist eng: Mutter und Kind, Kind und Mutter – sie treten, scheint es, einmal aus dem Dunkel hervor, oder traten sie ins Dunkel zurück? – es ist ein Klang aus Rembrandts Welt.
Bleibt endlich, dass wir uns nicht in Einzelheiten verlieren, ein Hinweis auf Ernst Hassebrauk, mit dem ich Ende der Zwanziger Jahre in Dresden in den Kollegs von Paul Tillich und Fedor Stepun gesessen habe. Mit ihm kehrte das Augustäische Zeitalter noch einmal auf die Kunstszene zurück, ein leidenschaftlich-brodelndes Temperament, treibt er in impulsiv-jäher Diktion alles in die Scheuer, was ihm vor Augen kommt. 1905 ist er geboren, 1974 ist er gestorben. Wenn ich recht sehe, hat der Feuertod Dresdens, seiner Stadt – meiner Stadt – ihn zu Tode verwundet. Wen hätte er nicht versehrt? Und so, angesichts der Vergänglichkeit aller Dinge, heimst sein fiebrig-hastiger Strich alles ein, um es aufzubewahren über den Tod hinaus.
War Hassebrauk ein Berserker der Malerei und ein Vielfraß auch im Geistigen, so haben wir in Joseph Hegenbarth und Rudolf Bergander ein ganz anderes Temperament vor Augen! Beide verwalten den Fundus ihrer Substanz und ihrer Mittel, sehr sorgsam, sehr bewusst. Und nun ist viel nicht mehr zu sagen. Nun ist alles nur noch eine Sache Ihres Spürsinns. Dies aber gilt: Jedes Blatt ist im Bereich des Könnens meisterlich, wert, dass man seine Botschaft ihm abfragt. “
Alfred Hoentzsch