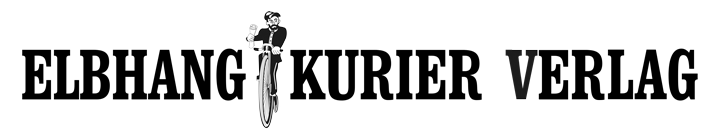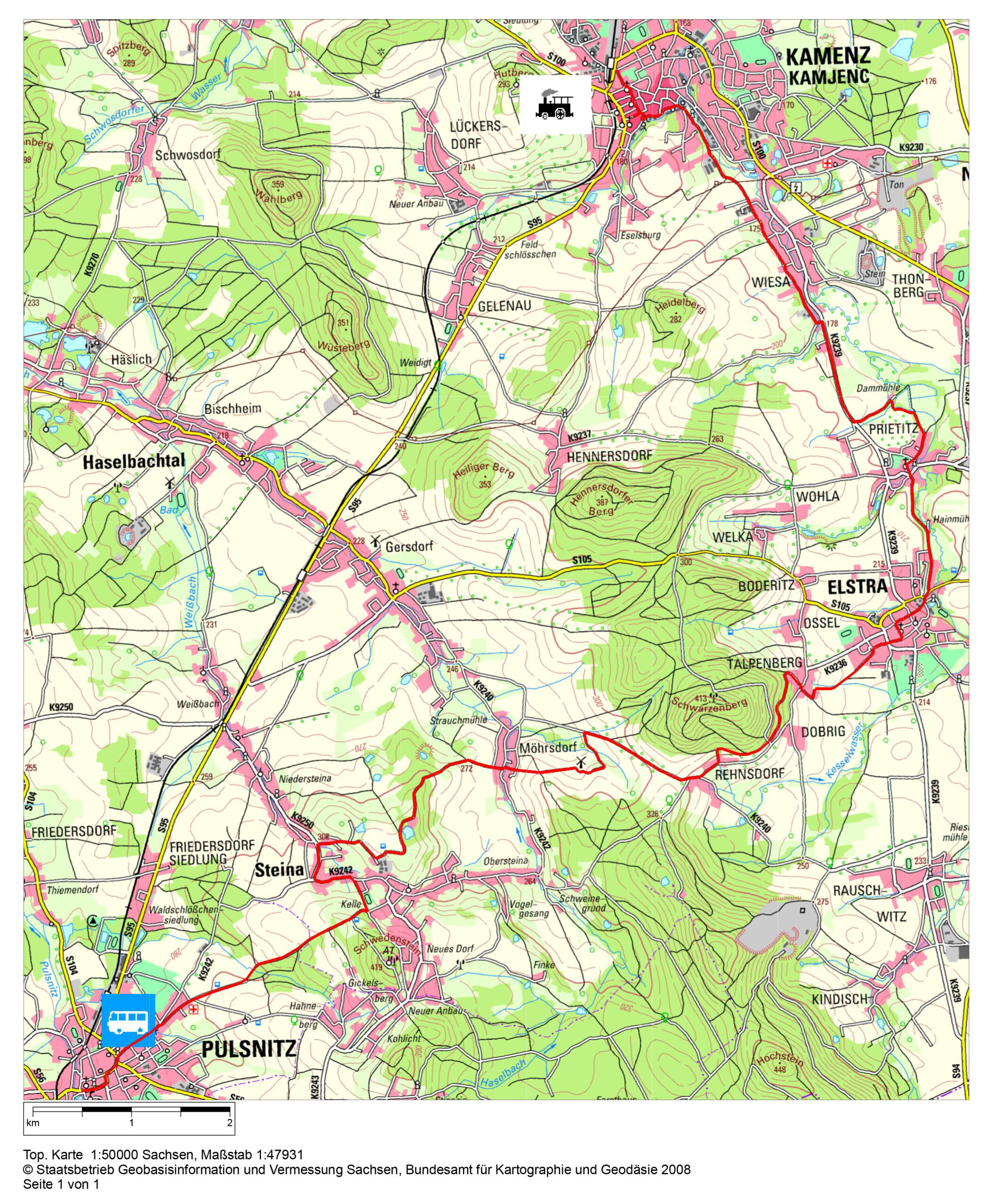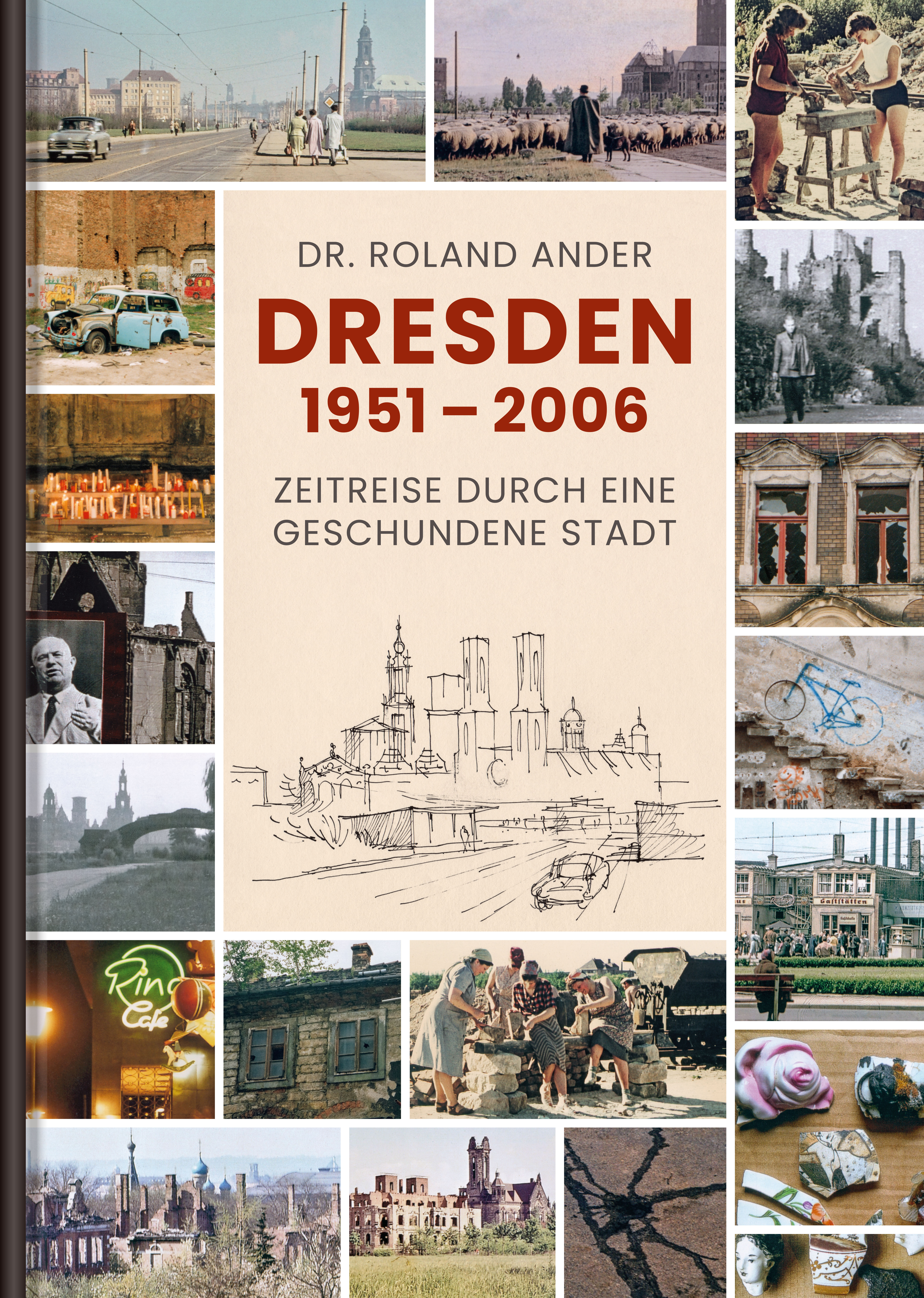»Zeigefinger in sächsischer Landschaft«
Juli 2024: Weg 11: »Von Kamenz über Elstra nach Pulsnitz«
von Dr. Michael Damme und Matthias Griebel
Von der Lessingstadt zu den Töpfern und Pfefferküchlern
Das Datum der 11. Wanderung stand schon länger fest, nämlich der 2.11.2012, der erste Freitag im November. Da fand nämlich zum 10. Mal der Pfefferkuchenmarkt in Pulsnitz statt. Eigentlich ist dieser Tag der erste Tag, an dem so etwas wie Weihnachtsvorfreude bei uns Sachsen aufkommen kann. Das absurde Weihnachtstreiben in den Einkaufstempeln ab etwa Anfang Oktober ist dagegen etwas abartig und kränkt die sächsische Volksseele – ehmd Marktwirtschaft. Der erste Wintereinbruch Mitte Oktober war Geschichte und für den Tag war ein gutes Wanderwetter angekündigt, das mich auch die ca. 17 km lange Strecke mit herrlichster Fernsicht begleitete. Mit dem Bus Linie 309 ging es gegen 7:30 von Dresden-Schillerplatz über Erkmannsdorf – Radeberg – Leppersdorf – Lichtenberg bis nach Pulsnitz – eine schöne Busfahrt, vorbei an den abgeernteten Feldern, den abgefischten Karpfenteichen und ab und zu am Himmel die Zugvögel auf ihren Weg nach Süden. Von Pulsnitz dann mit dem Schienenersatzverkehr bis Kamenz, meinem Ausgangspunkt. Ein Bummel durch die verschlafen wirkende Lessingstadt, an der historischen Via Regia liegend, lohnt sich. Und so ließ ich meine Tour mit einer ausgiebigen Stadtstreicherei beginnen.

Kamenz mit St. Marienkirche. Foto: Dr. Michael Damme
Vom Bahnhof ging es die Poststraße hinauf 0,3 km zur Klosterkirche St. Annen, an deren Giebel Gottfried Semper mit gearbeitet hatte. Der Marktplatz mit Rathaus, dem Hotel »Zum Goldenen Hirsch«, dem Andreasbrunnen von 1570 und den vielen wunderbar sanierten Bürgerhäusern zeigt mir wieder wie reizvoll die kleinen Städtchen sind und dass sie sich nicht hinter den Metropolen verstecken müssen. Eine gewisse Langsamkeit hat für uns Menschen sicher auch entscheidende Vorteile – man wünscht sie sich manchmal – selten lebt man sie. Über die Kloster- und Kirchstraße geht’s hinauf zur Hauptkirche St. Marien. Vom Friedhof fällt mein Blick auf den Roten Turm einem Überbleibsel der alten Stadtbefestigung. Über den Anger führt mich das kleine Rosengässchen hinab in den Grund auf den Mühlweg, der entlang des Baches namens »Langes Wasser« 0,5 km bis hin zum Wiesaer Kirchweg führt.
Kamenz (Kamjenc):
(sorbisch »Stein«, wie auch Chemnitz) war bereits um 1250 ein Burgward an der hohen Straße. In seinem ältesten Ortsteil »Spittel« (hier lag ein Spital) war 1248 der Gründungsort des Hausklosters der Herren von Kamenz, Marienstern, das dann in Panschwitz-Kuckau existiert. 1318 Stadt, trat Kamenz 1346 dem Oberlausitzer Sechsstädtebund bei. Das um 1500 gegründete »Schwarze Kloster« wurde schon 30 Jahre später säkularisiert, zu einer Lateinschule umgewandelt und bildet noch den Standort der Schule.
Stadtkirche ist die spätgotische evangelische Marienkirche in der Gestalt des 14. Jahrhunderts mit ihrer reichen Innenausstattung. Neben ihr, an der ehemaligen Stadtbefestigung, steht die kleine als Wehrkirche errichtete Katechismuskirche, die schon im 13. Jahrhundert erwähnt ist. Neben der Begräbniskirche St. Just aus dem 14. Jahrhundert ist noch die ehemalige Klosterkirche St. Annen von Bedeutung. Sie trägt auch die Bezeichnung »Wendische Kirche«, da in ihr nach der Reformation evangelischer Gottesdienst auf Sorbisch abgehalten wurde.
Ein erster großer Stadtbrand ist für 1707 bezeugt, bei dem in der Innenstadt nur ein einziges Gebäude (Feuerhaus am Anger/kurze Straße) erhalten blieb. Die heutige Stadtgestalt entstand im Wesentlichen nach einem weiteren Stadtbrand von 1842. Auf dem Markt steht der Andreasbrunnen von 1570, benannt nach seinem Stifter, dem Bürgermeister Andreas Günther, und das Rathaus im italienischen Rundbogenstil, das nach dem Brand von 1842 anstelle eines älteren entstand. Kamenz wurde 1729 die Geburtsstadt von Gotthold Ephraim Lessing.
Nach 2,6 km durch nach Landwirtschaft duftender Luft, vorbei an Kindern, die Drachen steigen lassen und Gänsen, die noch nicht ahnen, dass der 11.11., also der Martinstag vor der Tür steht, erreiche ich die Bischofswerdaer Straße, die ich notwendiger Weise 1,3 km entlang zotteln muss. Ein aus einem Stamm geschnitzter Bärtiger, in Prietitz-Anbau muntert mich auf.

Holzwerk Prietitz. Foto: Dr. Michael Damme

Prietitzer Dorfkirche. Foto: Dr. Michael Damme
Vor Prietitz biege ich links hinein in den Weg »Zum Park«. An der ev. St. Georgskirche stehe ich vor dem großen Grabmal der Gräfin Johanna Friederica Luise von Einsiedel – 0,6 km. An Kirche und alter Grundschule und am Bauernhof Hantsche sind sehr informative Schilder zur Geschichte angebracht – das freut den Wandersmann.
Prietitz (Protecy):
Man merkt dem als »Rodung« um 1200 entstandenen Ort seine ehemals herausragende Bedeutung nicht mehr an.
Hier deckte schon eine mittelalterliche Wehranlage die Semita Pribislawi, dem wahrscheinlich ältesten Höhenhandelsweg, der Meißen über Göda mit Bautzen verband.
Hier an der Schwarzen Elster soll schon 1280 eine Kapelle gestanden haben, welche als Vorgängerbau der heutigen Dorfkirche anzusehen ist.
Diese hier entstand im Jahre 1881 immerhin nach Plänen von Gotthilf Ludwig Möckel (1838–1915), einem renommierten Dresdner Kirchenarchitekten, der neben Kirchenbauten, wie Johanniskirche, Erlöserkirche und Briesnitzer Kirche auch auf Dörfern Gotteshäuser, wie die Prietitzer evangelische Georgskirche entwarf.
Das als Schloß bezeichnete, bis heute erhaltene Herrenhaus von 1770 bildete einst den Mittelpunkt des Rittergutsbesitzes der bedeutenden sächsischen Familie von Ponickau.
Über die Hauptstraße hinweg und am genannten Bauernhof vorbei geht’s entlang des »Alten Weges« parallel zur Schwarzen Elster, die im Tal dahin plättschert. Ein paar Granitbrückenpfeiler erinnern an die Zeiten, als hier noch eine Kleinbahn entlang dampfte. Dann weiter über den Hainmühlenweg 1,5 km bis nach Elstra. Vorbei an einer Töpferei am Ortseingang und einer alten, schon leicht verwitterten Postmeilensäule komme ich über die Klosterstraße auf den idyllischen Markt des Ortes an. Halbzeit meines Weges und Zeit für ein Picknick unter der Linde bei herrlichem Sonnenschein.
Elstra (Halštrow):
Das als »Ort an der Elster« um 1200 entstandene deutsche Kolonistendorf wird bereits 1329 als Stadt, aber schon 50 Jahre später wieder als Dorf bezeichnet. Erst 1528 erhielt es Stadt- und Marktrecht sowie ein Stadtwappen und blieb lange Zeit ein ländlicher Marktflecken.
Erst der Bau der Chaussee Kamenz– Bischofswerda sowie die Eisenbahnlinie Kamenz – Elstra 1890 beförderten die weitere Entwicklung.
Bedeutendstes Baudenkmal ist die anstelle eines Vorgängerbaues 1726 – 1756 errichtete Michaelskirche. Das Rathaus am Markt entstand 1717.
Aus dem Rittergut entstand nach einem Brand von 1907 der Neubau des Schlosses in Anlehnung an Formen des Jugendstils.
Die waldreiche Umgebung von Elstra weist auch Berge auf, wie den 413m hohen Schwarzen Berg oder den Sibyllenstein, mit 499 m ü. N.N. die höchste Erhebung der westlichen Oberlausitz.

Marktplatz mit Rathaus in Elstra. Foto: Dr. Michael Damme
Einmal um die Kirche herum marschiere ich die Schulstraße nach links und dann nach rechts die Pfarrgasse entlang und über den Stadtring. Ein Eingeborener beschreibt mir den Feldweg am »Ghetto«, so nennt er die Neubaublocks, vorbei in Richtung Talpenberg. Der Weg steigt auf der Länge von 1,9 km leicht an und im Rückblick sehe ich weit ins Lausitzer Land hinein. Selbst die Kühltürme des Kraftwerkes Boxberg sind klar am Horizont zu erkennen. Über das Berggässchen steige ich hinauf bis zum Skilift und da nach links durch den Wald, später am Waldrand entlang bis zu einem Wegweiser, der mir den Weg hinab zur Linde anzeigt. Die steht in Rehnsdorf vor dem gleichnamigen Gasthaus. Nach 2 km sitze ich mit einem Feldschlößchenbier in der Linde. Ja, richtig in der Linde – in die haben nämlich die pfiffigen Wirtsleute eine dezente Bühne eingebaut, von der man nicht nur Speis und Trank, sondern vor allem die herrliche Aussicht genießen kann. Gern würde ich hier noch länger verweilen, aber meine Freunde warten ab 15:00 auf dem Markt in Pulsnitz mit dem ersten Glühwein des Jahres auf mich. Also nichts wie los – weiter geht`s!

Gasthaus Zur Linde in Rehnsdorf (Hrancik). Foto: Dr. Michael Damme
Nach 0,2 km auf der Lindenstraße, in deren Straßengraben noch der erste Restschnee liegt, gehe ich etwa 0,6 km bis ein Feldweg links zu den Koppeln des »Islandponnyhofes« vorbei an einer alten Mühle und an den Pferdestellen 0,6 km hinab nach Möhrsdorf führt. Über die Haselbachstraße hinweg geht es den Sportplatzweg zum Sportplatz hinauf und da nach links den grün markierten Weg durch den Busch vorbei an gefluteten alten Steinbrüchen, wo jetzt Taucher sich eingerichtet haben. Nach 2,2 km erreiche ich Obersteina. Auf der Pulsnitzer Straße nach links und dann nach rechts in die Ohorner Straße und weiter nach rechts hinauf zum Schwedenstein auf dem ich nach 0,6 km ankomme. Der befestigte Weg geht nun in den unbefestigten Kirchweg nach Pulsnitz über. Hier kommen mir die ersten 2 Wanderer auf meiner gesamten Tour entgegen – die restlichen Millionen fahren Auto – na ja – da hab ich halt die Stille und die Natur für mich allein. Der Pfad führt nach 1,5 km direkt auf die Schwedensteinklinik zu – und nun? – komisch. Ich gehe einfach in die Empfangshalle und auf der anderen Seite wieder hinaus und denke »Sächs`sch is butz`sch!« Über die Dr.-Wilhelm-Külz-Straße, vorbei am Schützenhaus erreiche ich nach 0,6 km den Pfefferkuchenmarkt und meine Kumpels, die mich mit einem Pfefferkuchenglühwein begrüßen.
Der Nachtwächter preist wie jedes Jahr jeden der 9 praktizierenden Pfefferküchler über den grünen Klee an. Der Pulsnitzer Spielmannszug marschiert durch das fröhliche Markttreiben und der Junge mit der Lefimapauke haut mächtig drauf. Der Ladeninhaber des Indischen Textilladens, ein waschechter Pulsnitzer, beobachtet mit seiner Frau freundlich das Treiben und die ersten Besucher schleppen mit Pfefferkuchentüten schwer beladen das weihnachtliche Naschwerk davon. Auch wir bunkern noch Pfefferkuchen und gehen von der böhmischen über den Pulsnitzbach auf die meißnische Seite, denn hier verlief früher die Landesgrenze, zur Bushaltestelle der Linie 309 die uns nach Dresden zurückbringt.
Unser Weg führte uns über den Ostrand der Landschaft des Westlausitzer Hügel- und Berglandes. Über den Granodioritgesteinen bildeten sich Lössböden mit hoher Bodenqualität, so dass hier die Landwirtschaft eine gute Arbeitsgrundlage vorfindet.
Pulsnitz (Polcina):
Das am gleichnamigen Gewässer um 1200 angelegte Waldhufendorf wird schon 1318 als planmäßig angelegtes Städtchen genannt, das 1355 zuerst Markt- und erst 20 Jahre später reguläres Stadtrecht erlangte. Der Ort teilte sich auf beiden Seiten des Grenzflusses die Hoheitsrechte: zum einen als Böhmisches Grenzland, das die Oberlausitz bis 1635 war, und zum anderen war es der Mark Meißen zugehörig. Die evangelische Stadtkirche St. Nikolai, ursprünglich eine spätgotische Hallenkirche, wurde nach einem Brand von 1742 wieder aufgebaut. Der quadratische Nordturm mit achtseitigem Glockengeschoß wurde 1749 vollendet; Haube und Laterne stammen von 1781. Das am Park gelegene Schloßareal erhielt seine Bauten (heute Klinik) im 18. Jahrhundert. Am Markt das auf einen Renaissancebau von 1555 zurückgehende Rathaus sowie das Denkmal für den in Pulsnitz geborenen Bildhauer Ernst Rietschel (1804–1861).
Das Recht Pfefferkuchen zu backen, erteilte den Pulsnitzer Bäckern eine Innungsurkunde vom 1. Januar 1558. Nach der Wende sollte auch dieses uralte Gewerbe »abgewickelt« werden.
Seit April 1998 gilt jedoch die novellierte deutsche Handwerksordnung, in welcher der Fortbestand der Pfefferküchlerei in Pulsnitz festgeschrieben ist.

Der jährlicher Pfefferkuchenmarkt in Pulsnitz. Foto: Dr. Michael Damme