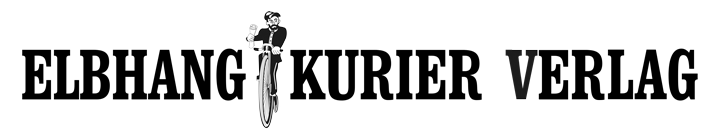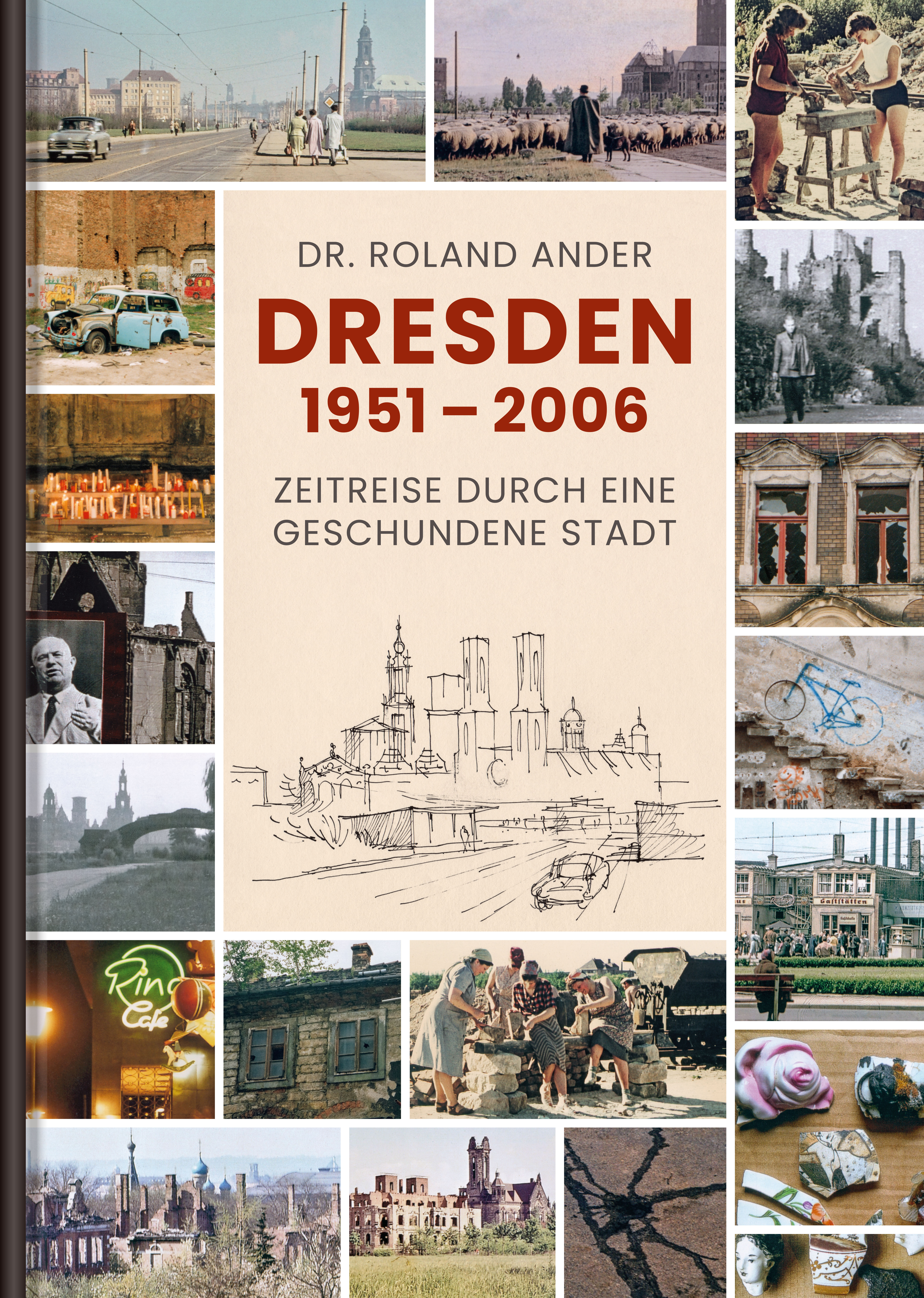Auszüge aus der Grabrede – die Blasewitzer Architektin und Grafikerin starb 88-jährig und wurde am 15. Juni auf dem Loschwitzer Friedhof begraben.
Wer Krista Grunicke nur durch die beglückende Schönheit ihrer in den letzten beiden Lebensjahrzehnten entstandenen Druckgrafiken und Monotypien kennengelernt hat, wird kaum vermuten, dass mit ihrem friedlichen Einschlafen am 3. Juni, zwei Tage vor ihrem 89. Geburtstag, ein eher dramatisches Leben zu Ende gegangen ist, wozu Zeitumstände wie naturell alternierend beigetragen haben mögen.
Dabei war ihre Herkunft aus bäuerlich – mittelständischen Kreisen sicher ein starkes Pfund, um diese immerhin fast 89 Lebensjahre voll Engagement, Kampf, Erfolg oder Misserfolg und Schicksalsschlägen durchzustehen. Sie kannte schon bald die Strapazen des Landkindes, als zum Besuch einer höheren Schule die tägliche Tour von Seifersdorf nach Dresden fällig wurde. Ein Wort der Eltern, wonach sie eigentlich „ein Junge werden sollte“, ging ihr lange nach und ist, wie in vielen Biografien, mehr als nur eine Maginalie gewesen: fast lebenslang musste Grunicke gegen die Vorbehalte einer patriarchalischen Gesellschaft ankämpfen, bisweilen dann auch schon in vorlaufender Frontstellung.
In Ausbildung und Berufswahl fahren nicht nur die Wirren von Krieg und Nachkrieg hinein, sondern auch – nie verwunden – der „Heldentod“ eines jungen Mannes, mit dem gemeinsam sie ihre Zukunft gesehen hatte. Ihr Berufswunsch ging a priori nicht, wie ungefähre Kenner ihrer Vita annehmen könnten, auf’s Architektonische, sondern auf die freie Kunst hinaus. Aus dem Studienbeginn an der Dresdner Kunstakademie 1943 wird bald der Arbeitsdienst als Rotkreuz-Schwester für Flüchtlinge; auch die Fortsetzung nach Kriegsende fordert mehr die Trümmerfrau, bis ein Praktikum bei dem Architekten Herbert Schneider ihrem Leben eine andere Richtung gibt. Nach einer Zimmermannslehre und einschlägigen Studien in Dresden und Leipzig tritt sie eine Stelle am hiesigen Stadtbauamt an. Im Team des nunmehrigen Stadtarchitekten Schneider ist sie an den Entwürfen für die Ostseite des Altmarktes, der Freilichtbühne „Junge Garde“ beteiligt, die mittlerweile allerdings von einer gewaltigen Rockbühne überragt und noch mehr Lärm übertönt wird. Das reizvolle Puppentheater im Großen Garten ist dann vollständig Grunickes Eigenwerk.
In der großen Architekturflaute nach dem Mauerbau werden Stadtarchitekt Schneider, seine Mitarbeiterin und weitere Kollegen aus dem Stadtbauamt geworfen. Für Krista Grunicke beginnt wiederum die Arbeitssuche und sie kann schließlich an der TU bei dem nachmaligen Prof. Bernhard Klemm, der in dieser für viele Architekten brotlosen Situation etliche Zunftgenossen mit Honorarverträgen über Wasser hielt, an Sanierungsplanungen für die historische Neustadt und die Altstadt von Schmalkalden mitarbeiten.
Als der Verband Bildender Künstler Ende der 60er Jahre die Möglichkeit bot, Architekten mit der fantasievollen Spezifikation „Museumsgestalter“ die Mitgliedschaft zu gewähren, was einer freischaffenden Tätigkeit mit der Beschränkung auf Innenraumgestaltung gleichkam, begann Krista Grunickes beste Schaffenszeit. Den älteren unter Ihnen, in Sonderheit den Architekten, aber ebenso vielen Bürgern, die darin so etwas wie Heimat empfanden, werden ihre Ausstattungen von Gaststätten, Bars, Standesämtern, fallweise tatsächlich auch Museen, unvergessen sein. Grunicke schuf echte Erlebnisräume in einer Zeit, die sonst Einrichtungen dieser Art mit einer Plaste-Latex-Masche und entsprechendem Duft das unisone Flair des Unbehaustseins verlieh.
Aber: Ihre einfallsreichen Gestaltungen des Weinkellers der Secundogenitur, der Altmarktbar oder des Friedrichsschlösschens in Großsedlitz, des Puppentheaters am Goldenen Lamm und des Leipziger Kaffeebaumes – es gibt sie alle nicht mehr. Sie sind samt ihrer liebenswerten Details und der originär-postsurrealistischen, teils raumhohen Fotomontagen meist noch in der DDR der zyklischen Renovationswut ihrer jeweiligen Betreiber zum Opfer gefallen. Der Rest überstand die Wende nicht nicht mehr lange. Sieht man von Teilhabe und Eigenleistung bei den schon genannten Hochbauten ab, so ist das Werk der Architektin Krista Grunicke noch nicht einmal adäquat dokumentierte Geschichte.
Wie lebt einer damit, wie ist Krista Grunicke mit dieser Negativerfahrung umgegangen? Ihr Lebensziel der Frühe, das eigentlich Künstlerische bricht sich gottlob nun in den 90ern endlich mit voller Kraft Bahn. Es entstehen, erst tastend und kleinformatig, neben Zeichnungen vornehmlich Farbmonotypien, bis die Künstlerin das Feld ihrer Möglichkeiten entdeckt, erweitert und bald, in enger Arbeitsbeziehung zur Dresdner Grafikwerkstatt um Angela Hampel und Udo Haufe, weit ausschreitet. Nun schafft sie Algrafien, Radierungen, vor allem aber großformatige Linolschnitte ohne Assoziationen zu irgendwelchen Vorbildern.
Grunickes Bildvorwände erscheinen verbal simpel: Alltägliches wie Menschen, Katzen, Bäume, Steine. Ihre Gestaltungen aber sind lapidar und vielschichtig zugleich: extenzielle Situationen. Einen herausragenden Höhepunkt makieren für mich die riesigen, ein- oder mehrfarbigen Linolschnitte, in denen Grunicke für menschliche Befindlichkeiten eine besonders prägnante Form gefunden hat.
Bemerkenswert an dieser grafischen Kunst ist ihr künstlerischer Eigenstand, der keine Fremdanleihen erkennnen lässt. Ebenso wesentlich und für die Künstlerin lebensnotwendig war, dass da zwar viel ernst Erfahrenes waltet, aber kein Verdruss über unwiederbringlich Verlorenes nachklingt. Krista Grunicke hat im Aufgriff früher Ansätze ihr Lebenswerk ins rein Bildnerische münden, ihr Licht auf andere – und bleibende – Art leuchten lassen, manchen dabei eins aufgesteckt und für sich selbst Frieden gefunden. Uns bleibt ihr spätes Werk – ein Duell der Schönheit.
Jürgen Schieferdecker