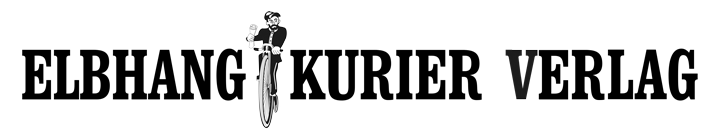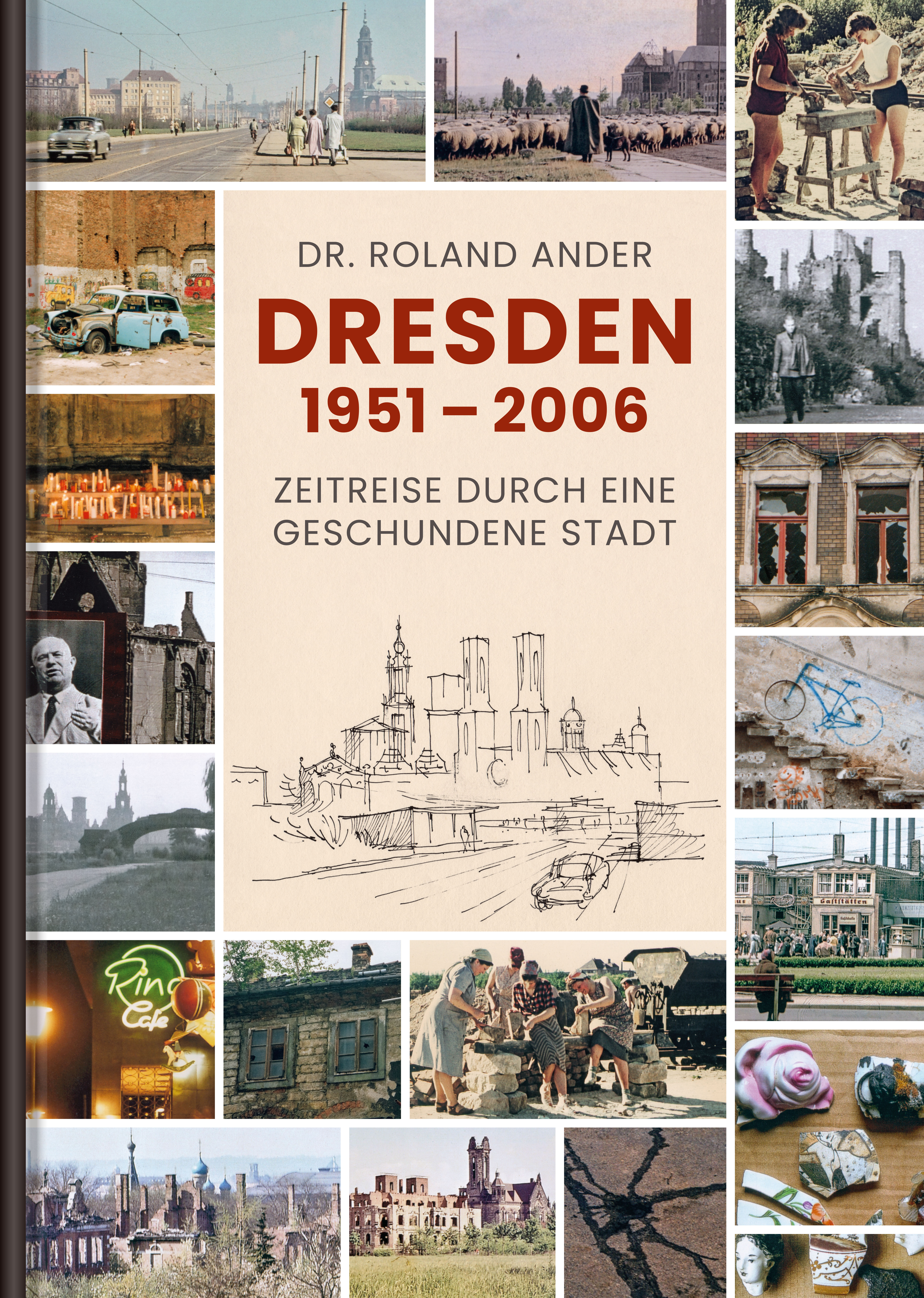Ungekürztes Interview mit Pfarrer i. R. Christoph Flämig, mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt, zum Wendejahr 1989
Christoph Flämig (geb. 1940) lebt als Ruheständler mit seiner Frau in Loschwitz und arbeitet noch ehrenamtlich als Gemeindeberater der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens. Von 1986 bis 1997 war er Pfarrer auf dem Weißen Hirsch und organisierte nach 1990 in dieser Funktion auch die Unterstützung für ein Kinderheim in Pribuschkoje bei Winniza (Ukraine). Er war im Dezember 1989 Mitbegründer der Bürgervertretung Weißer Hirsch und ab1990 Mitinitiator der Sozialstation BÜLOWH. Als Stadtrat (1990 bis 1997) war er an vielen wesentlichen Entscheidungen beteiligt.
Er ist u. a. Mitglied im Förderverein der Hochschule für Kirchenmusik, im Förderverein des Dresdner Kreuzchores, im Förderverein der Sozialstation und im Förderverein der Straßenzeitung „Drobs”. Am 5. Dezember 2008 erhielt er für sein ehrenamtliches Engagement aus der Hand des Bundespräsidenten Horst Köhler das Bundesverdienstkreuz. Christoph Flämig war in den Wendetagen 1989 eine Integrationsfigur, nicht nur auf dem Weißen Hirsch. 20 Jahre danach fragten wir ihn nach seinen Erlebnissen und Gedanken in diesen Monaten.

Christoph Flämig, Pfarrer im Ruhestand – aber nicht außer Dienst.
Foto: Jürgen Frohse
Elbhang-Kurier: Herr Flämig, herzlichen Glückwunsch zur Verleihung des Bundesverdienstkreuzes. Sie waren lange Jahre Pfarrer auf dem Weißen Hirsch. Können Sie sich erinnern, wie Sie Silvester 1988 und 1989 erlebten, was Sie eventuell in Ihren Predigten der Gemeinde mit auf den Weg gaben?
Christoph Flämig: Da müsste ich in den Silvesterpredigten nachschauen… Die Predigt für den letzten Gottesdienst des Jahres 1988 habe ich nicht in Stichworten notiert. Hingewiesen habe ich auf Ereignisse des Jahres 1988. Zum Beispiel das Fischsterben in einem Bach in der Sächsischen Schweiz, das Hinausstoßen eines Afrikaners aus einem fahrenden Zug und die Passivität der Fahrgäste, die Ökumenische Versammlung in Dresden im Rahmen des „Konziliaren Prozesses”, das Verbot der Zeitschrift Sputnik, die„Kristallnacht” sollte ab diesem Jahr „Judenpogrom” genannt werden. Ich fragte in der Predigt, was mich und andere am Jahr 1988 schmerzt.
Ich nannte: Menschen sind weggegangen. Es fehlte ihnen an Möglichkeiten und an Fähigkeiten, diese Situation auszuhalten und zu verändern. Die Engstirnigkeit und Unbeweglichkeit von Trägern der Macht. Eigenes Versagen, wo ich nicht ermutigen konnte, überzeugende Möglichkeiten unzureichend beschrieben habe und die Nähe der Liebe Gottes nicht deutlich machen konnte. Eigene Blindheit gegenüber ermutigenden Ereignissen.
Ich fragte dann, was andere und ich im Jahr 1988 lernen konnten und gelernt haben. Hier nannte ich: Sich Problemen neu stellen, sich zu öffnen und sie nicht zu verdrängen, ist schmerzhaft, kostet Kräfte und ist mühsam. Es ist aber möglich, es macht auch Freude, u.a. im Näherkommen zu anderen, die Ähnliches wollen. Es ist nicht sinnlos, auch wenn Ziele und Wünsche irgendwie hinter dem Horizont schlummern. Diesem Horizont sind wir näher gekommen. Wir haben wieder entdeckt, dass die Bibel ein hochaktuelles Buch ist. Mein letzter Satz und damit das Fazit lautete: Ich liebe das Jahr1988, denn es hat mich reicher, reifer und mutiger gemacht und wichtige Teile liegen mir im Herzen. Diese Predigt ist etwa zwanzig Jahre alt. Zwischenzeitlich hatte ich sie mir nicht mehr angesehen. Ich bin angenehm verblüfft.
Ein Jahr später sah die Einschätzung sicher ganz anders aus?
Im letzten Gottesdienst des Jahres 1989 bezog ich mich in der Predigt auf den Monatsspruch vom Dezember „Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade über Gnade” und auf dem Lehrtext vom 31. Dezember 1989 „Laßt uns Gutes tun und nicht müde werden; denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen”.
Ich konnte sagen: Der heutige Jahresschlussgottesdienst ist für mich ein Dankgottesdienst, denn ein Machtgebäude ist zerfallen wie ein Kartenhaus; die Erschütterungen brachten nicht die Hammerschläge der Gewalt, sondern der Wind der Gewaltlosigkeit hervor; Menschen kamen aus ihren Nischen und prägten die Öffentlichkeit; Kirchen und Gemeinden ernteten die Früchte der zeitweise nicht geliebten Machtlosigkeit; Dankbarkeit setzt Energien frei; diese Energien sind Material, um Gutes zu tun, wie Missverständnisse zu verhindern, Unrecht zu benennen, auf Risiken hinzuweisen, den Egoismus zu knacken, Gottes Erwartungen zu benennen, Proexistenz statt Konsum zu praktizieren.

Chor der Gemeinde Weißer Hirsch mit ihrem Pfarrer.
Foto: Große-Haupt
Die Zeit auf dem Weißen Hirsch vor 1989 beschreibt Uwe Tellkamp sehr eindrücklich in seinem Buch „Der Turm”. Können Sie diese Sicht teilen?
Wenn ich an die Entwicklung und an die besonderen Ereignisse denke, die in Dresden eine Rolle gespielt haben und die die Dresdner prägten, so fehlen mir in diesem Buch zwei wesentliche Dinge: Die Kommunalwahlen im Jahr 1989 und der „Konziliare Prozess” aus dem kirchlichen Bereich, den viele Hirsch-Bewohner mit organisiert, mitgestaltet und mit vertreten haben. Von dem Anspruch ausgehend, nur den Weißen Hirsch zu beschreiben, wären das schmerzliche Lücken. Ich interpretiere das Buch aber so, dass der Autor die gesamte DDR-Gesellschaft symbolisch auf dem Weißen Hirsch konzentrierte.
Wie hat sich der „Konziliare Prozess”, der 1983 in Vancouver begann, auf dem Weißen Hirsch ausgewirkt?
Auf dem Weißen Hirsch gab es immer ein großes Interesse an elementaren Dingen. Dieses Interesse äußerte sich in vielen Gesprächen und führte dazu, dass sich themenbezogene Kreise bildeten und selbst organisierten. So gab es Jahre vor der Wende in der Kirchgemeinde u. a. einen Friedenskreis, einen Erziehungskreis, einen Kreis „stud. christ.” und verschiedene Elterninitiativen.
Die Mitglieder dieser Kreise hatten das große Bedürfnis, bestimmte Entwicklungen zu verstehen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten mit zu beeinflussen, sich sprachfähig zu machen vor sich selbst, vor ihren Kindern und vor allem vor anderen Personen aus dem Partei- und Staatsapparat. Sie bemühten sich um die Botschaft, dass ihre Positionen für die Gesellschaft der DDR nicht schädlich, sondern sehr nötig sind. Die Themen des „Konziliaren Prozesses” Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung ergänzten und förderten das Nachdenken und Verhalten vieler Menschen auf dem Weißen Hirsch.
Gaben Sie immer die Richtung in der Gemeinde vor?
Gemeindeglieder auf dem WeißenHirsch legten schon vor meiner Zeit großen Wert auf innere Selbstständigkeit. Sie verstanden sich nicht als Schafe, die von ihrem Hirten angetrieben und umsorgt werden wollten. Das Gemeindebild von einem Leib mit vielen Gliedern lag ihnen viel näher. Jeder und Jede hatten Gaben und Begabungen, die sie einbrachten. Ich habe an diesem Selbstverständnis nicht gerührt. Ich habe sie an ihre speziellen Gaben erinnert. Ich habe diese Gaben im Interesse der Gemeinde genutzt. Und ich konnte meine Gaben entfalten, wie z. B. Moderation und Impulse.

„Montags-Demo“ auf dem Theaterplatz, November 1989.
Foto: U. Haessler
Womit beschäftigte sich beispielsweise der Friedenskreis?
Es ging u. a. um den ganz persönlichen schlichten und echten Beitrag des Einzelnen zur Lebensfähigkeit des Friedens in dieser Hochphase des Kalten Krieges. Es ging darum, im Alltag der DDR zukunftsfähige und persönliche Zeichen des Friedens zu verwirklichen. Große Themen waren ja die vormilitärische Erziehung im Rahmen des Wehrkundeunterrichtes an Schulen, Wehrersatzdienst als Bausoldat und als eindeutig nichtmilitärische Variante der Soziale Friedensdienst. Wie schon obengesagt, spielte die Arbeit an der Sprachfähigkeit eine große Rolle. Das Gegenüber aus Schule, aus Staats- und Parteiapparat sollte mich nicht als Gegner einordnen, sondern als mitdenkendes und mitgestaltendes Glied der DDR-Gesellschaft.
Im Mai 1989 gab es Kommunalwahlen in der DDR. Wie verfolgten und erlebten siedieses Ereignis auf dem Weißen Hirsch?
Die Wahlen in der DDR nannten sich Wahlen, ohne diesen Namen zu verdienen. Sie waren eine hochorganisierte Form von Akklamation und damit von Entmündigung der Bürger. Wer sich dieser Akklamation entziehen wollte, musste viel Energie aufbringen und ein gewisses Risiko auf sich nehmen.
Im Frühjahr 1989 deutete sich ein anderes Verhalten an. Das Interesse an der Zahl der tatsächlichen Neinstimmen im Gegenüber zum offiziell verkündeten Ergebnis war deutlich zu spüren. Die sogenannte Kandidatenaufstellung war wie immer formal öffentlich und fand im Weißen Adler statt. Es war nicht üblich, dabei Fragen zu stellen, aber dieser Brauch wurde erstmals durchbrochen. Besucher, auch ich, stellten Fragen, die man sich vorher nie getraut hätte. Für den Wahltermin wurde untereinander abgesprochen, dass es gut sei, die Auszählung in sämtlichen Wahllokalen zu besuchen und die Ergebnisse mitzuschreiben.
So geschah es. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass viele Bürger zur Auszählung in das Wahllokal strömten und fleißig ihre Notizen machten. Die Landeskirche sammelte die Daten und wertete sie aus. So bekam man ein realistisches Bild des Wahlverhaltens und der Wahlergebnisse, das sich von dem von Egon Krenz im Fernsehen bekannt gegeben Daten sehr unterschied. Für mich war es eine große Enttäuschung, dass das System nicht den Mut gefunden hatte, sich von seinem Ritual der 99,9 Prozent zu trennen. Auf der anderen Seite erlebte ich eine sinnvolle Solidarisierung von Menschen, die sich ein Stück ehrlichere DDR wünschten.
Pfarrer findet man sehr selten in der Politik. Waren die Wahlen und die Enttäuschung über den Betrug ein Auslöser für Sie, sich politisch zu engagieren?
Die Sehnsucht, Verantwortung wahrzunehmen, auch politische, hatte ich immer. Auf meiner ersten Pfarrstelle im Vogtland fragte mich ein Gemeindeglied, das auch Mitglied der CDU war, ob ich denn bereit wäre, in diese Partei einzutreten. Ich sagte ihm: Wenn ich eintrete, will ich mitreden, Vorschläge unterbreiten unabhängig von dem, was von oben erwartet wird. Das Modell der Akklamation sei nichts für mich. Die CDU hat mich nie wiedergefragt. Ein Pfarrer nimmt ja in Ausübung seines Berufes gesellschaftliche Verantwortung war, da er Menschen begleitet, sich um Menschen (seel)sorgt, Gottes Zuwendung verkündigt. Unabhängig vom Gesellschaftssystem, in dem er wirkt, ist das faktisch auch politische Verantwortung, da die Gesellschaft dadurch mitgeprägt wird. Ich war aus diesen theologischen Gründen bereit, mich auch in politischen Strukturen zu engagieren.

Skulpturen der Hofkirche „blicken“ auf die Künstler-Demonstration am 19. Novemver 1989.
Foto: U. Haessler
Wann war für Sie die Ohnmacht des politischen Systems deutlich?
Ohnmacht? Ich würde von Brüchigkeit reden. Vorläufer waren für mich die Schummelei mit den Ergebnissen der Kommunalwahl und das Abblocken des „Konziliaren Prozesses” durch die DDR. Verdichtet hat sich die Brüchigkeit im Oktober 1989. Es kam zu den Botschaftsbesetzungen und zu dem Wahnsinnsprojekt, die Züge mit den Botschaftsflüchtlingen durch die DDR zu leiten. Das war eine tödliche Gier nach Souveränität seitens der DDR. Viele Ausreisewillige strömten an die Dresdner Bahngleise, begleitet von innerlich sehr bewegten Dresdnern. Es folgten massive Polizeieinsätze, viele Verhaftungen und schikanöse Behandlungen der Festgenommenen. Für mich zeigte das System faschistoide Züge. Damit entwertete und entleerte es sich selbst. Da war mir klar, so kann es nicht weitergehen.
Wer Sie kennt wird wissen, dass Sie kein Barrikadenkämpfer sind. Sie suchen die Auseinandersetzungen mit dem Wort und nach pragmatischen Lösungen. Was unternahmen Sie?
Es ergab sich ein Mosaik von vielen verschiedenen Handlungen. Gemeindeglieder und ich sammelten die Namen der Inhaftierten. Für jede Person brannte in der offenen Kirche ständig eine Kerze. Wir freuten uns sehr bei ihrer Rückkehr. Die Inhaftierten wurden ermutigt, Gedächtnisprotokolle über das Erlebte zu schreiben. Diese wurden vom Jugendpfarramt gesammelt und von der Kirche der Staatsanwaltschaft mit Klageaufforderung übergeben.
Im kleineren vertrauten Kreis wurden die Möglichkeiten und die Notwendigkeit politischen Engagements in der Region angesprochen. Ich beteiligte mich an den Montags-Demos. Bei jeder Gelegenheit wurde viel miteinander gesprochen, sei es auf der Straße, sei es bei Veranstaltungen. Ich entdeckte, wie Menschen auf dem Weißen Hirsch sich mit ihrem bisherigen Lebensentwurf beschäftigten und über Veränderungen nachdachten.
Vor einigen Tagen übergab mir eine Bekannte eine Kirchenblatt der Kirchgemeinde Weißer Hirsch, das sie beim Aufräumungen wieder gefunden hatte. Es war das Exemplar für die Monate Dezember 89 und Januar 90. Darin war eine Dreiteilung üblich: 1. Veranstaltungen; 2. Allgemeine Informationen; 3. ThematischesWort, in der Regel vom Pfarrer geschrieben. Das thematische Wort habe ich bereits im Oktober formuliert, da das Manuskript der Druckgenehmigungsstelle vorgelegt werden musste. Ich wollte auf die neue Situation eingehen und eine Deutung versuchen. So verglich ich die DDR mit einer Bahn im permanenten Kreisverkehr und schrieb: „Inzwischen fuhr der Zug so langsam, dass die Mitfahrer beschlossen, zu Fuß weiterzugehen. So erreichten sie vor dem Zug die nächste Weiche. Diese Weiche stellten sie um, damit der Zug aus dem Kreisverkehr herausfahren konnte. Als der Zugführer mit seinem Personal dies bemerkte, schimpfte er kräftig, verlangte Wiederherstellung des alten Zustandes und hielt den Zug an. Da schoben ihn die ausgestiegenen Mitfahrer mit Händen und Füßen über die umgestellte Weiche”. Botschaft sollte sein, dass von Weichenpflege und Weichenkontrolle es abhängt, wohin der Zug unserer Gesellschaft fährt: Auf der Strecke ausgefahrener Erstarrung oder auf der Strecke echter Veränderung. Sinngemäß schrieb ich in einem Nachsatz über und für den Mitarbeiter der Druckgenehmigungsstelle, wenn dieser Beitrag unverändert im Dezember im Kirchenblatt zu lesen ist, hätte er wichtiges von den Veränderungen begriffen. Es war übrigens das letzte Kirchenblatt, das die Dienststelle der Druckgenehmigung passieren musste.
Im November fiel urplötzlich die Mauer. Wie erlebten Sie dieses historische Ereignis?
Die Tage im September, Oktober und November waren geprägt von Ausreisen aus der DDR und von weiteren neuen Antragstellungen – ein Aderlass, der zur Leblosigkeit der Restbevölkerung hätte führen können. Insofern war dies für mich ein großes und bedrückendes Thema. Und oft ist es so, dass große und kleine Ereignisse sich neckisch ergänzen. Einer meiner im Westen lebende Onkel feierte Mitte November einen hohen und runden Geburtstag und ich hatte die Reisegenehmigung bereits in der Tasche. Diese partielle Reisefreiheit hat mich von den anderen Ungerechtigkeiten etwas abgelenkt. Den Fall der Mauer habe ich mit staunendem Zögern erlebt. Die Schizophrenie des Systems wurde gravierend deutlich. Wenn Offiziere an der Grenze plötzlich sagen, lassen wir es laufen, heißt das ja vor allem, dass alle Argumente, die vorher an sie herangetragen wurden, ihr negatives Vorzeichen verloren hatten. Das Entscheidende war nicht, dass sich Beton bewegte, sondern das Verantwortungsträger des Systems an Schaltstellen begriffen: Die Entwicklung ist weitergegangen. Es ist klug, wenn wir das respektieren.
Welche Wege suchten Sie, sich politisch Gehör zu verschaffen. Hatten Sie Kontakte zum „Neuen Forum” oder zur „Gruppe der 20”?
Uns beschäftigte natürlich die Frage: Wie sollte und wie könnte es weitergehen? Mit Sehnsüchten, mit Wünschen und auch mit Ideen waren wir reichlich gefüllt. Welche Form sollte unsere Bereitschaft zur Verantwortung bekommen? Ein konkretes Ergebnis war die offizielle Gründung der Bürgervertretung Weißer Hirsch Anfang Dezember. Da die Vorbereitungsgruppe komplett zur Kirchgemeinde gehörte, nutzten wir dafür die Kirche. Es gab einen Vorstand, in dem ich den Vorsitz übertragen bekam. Wir bildeten Arbeitsgruppen. Darin konnte jeder mitarbeiten, auch unabhängig von seiner politischen Vergangenheit. Wir suchten die Vernetzung mit anderen Bürgervertretungen. In der Stadt hatte die „Gruppe der 20” ebenfalls Arbeitsgruppen gebildet und suchte ebenfalls Kontakt zu den Bürgervertretungen im Gebiet von Dresden.
Es mündete in die Vorbereitung auf die Kommunalwahlen. An Parteien wollte ich mich nicht binden. So schloss ich mich der„Freien Wählervereinigung – Gruppe der 20” an, wurde gewählt und blieb nach meiner Wiederwahl1994 bis 1997 im Stadtrat.

Das Bundesverdienstkreuz für Christoph Flämig aus der Hand von Bundespräsident Horst Köhler.
Foto: Jürgen Frohse
Konnten Sie den Pfarrer mit dem Politiker in ihrer Person vereinen?
Politisches Engagement war für mich nicht zu trennen von kirchlichem Engagement. Was ich politisch einbrachte, tat ich als Pfarrer, auch im Stadtrat. Ich verstand mich dort auch als Vertreter meiner Kirche. Sachlichkeit im Umgang mit den Argumenten anderer Fraktionen und die menschliche Hochachtung gegenüber Mitgliedern anderer Fraktionen waren mir wichtig. Einen völligen Wechsel in die Politik unter Verzicht auf kirchliche Bindungen und Ämter habe ich bei gezielten Nachfragen immer abgelehnt. Von diesem Fundament wollte ich mich nicht lösen. Ich leide heute noch darunter, wenn man den politischen Gegner menschlich fertig macht, weil die Sachargumente fehlen. Für mich ist das u. a. Missachtung der Wende.
Können Sie konkret Entscheidungen benennen, die Sie im Stadtrat auf den Weg brachten oder Ihnen besonders am Herzen lagen?
Interessanterweise fallen mir zuerst die Beschlussvorlagen ein, die ich abgelehnt habe. Dazugehören der Wiederaufbau der Frauenkirche und der Bau der Waldschlößchenbrücke. Bei der Frauenkirche sah ich in der Ruine eine bessere Nachdenk- und Lernmöglichkeit für die Dresdner und ihre Gäste. Die Mehrheit sah das anders. Inzwischen respektiere ich die getroffenen Entscheidungen. Anbetung und Kultur bilden im Alltag den Schwerpunkt dieser Kirche. Die Idee eines Friedenszentrums benötigt aber noch eine Menge geistige und geistliche Investitionen.
Die Zahl der Beschlussvorlagen, denen ich zugestimmt habe, geht in die Hunderte. Konkret möchte ich die Entscheidung über das Sanierungsgebiet Loschwitz nennen, wo ich durch einen Ergänzungsantrag Loschwitz in den Kreis der Sanierungsgebiete mit aufnehmen lassen konnte. In der Anfangsphase des Stadtrates gab es einen fraktionsübergreifenden Personalausschuss, der die Ablösung alter Kader und sinnvolle Neubesetzungen als Aufgabe hatte. Ich gehörte dazu und habe in dieser Runde z. B. Peter Rauch als Leiter des Ortsamtes Loschwitz vorgeschlagen. Dafür gab es grundsätzlich grünes Licht. Allerdings verlangte OB Wagner – wir tagten am Abend – bis zum nächsten Morgen 8 Uhr die Zustimmung des Vorgeschlagenen. Peter Rauch hat dann statt zu schlafen eine Nacht darüber nachgedacht und am Morgen zugesagt.
Mit den Volkskammerwahlen wurde immer deutlicher, dass ein sogenannter dritter Weg nicht möglich war und die DDR-Bürger die Einheit wollten. Sie hatten Sympathien mit dem Sozialismus-Modell, wie Sie vorhin sagten. Tat es Ihnen leid?
Ich meine, dass das Sozialismus-Modell in der Urform des Wortes in die politische Landschaft unserer Erde gehört. Der Kapitalismus braucht Alternativen und Infragestellungen, sonst verfettet er. Sozialismus und Diktatur einer Gruppe gehören nicht automatisch zusammen. Wir haben eine sehr erbärmliche Kombination davon erlebt. Darum ist es nicht schade.
Es verwundert mich – Sie als ein Mann der Kirche finden Gefallen an sozialistischen Ideen?
Mir geht es um das gedankliche Modell, nicht um die Wiederholung bereits erlebter sogenannter Umsetzungsversuche.
Glaube und Kirche hatten aber in den Theorien der Marxisten keinen Platz. Andere sozialistische Regime, siehe die Tschechoslowakei, gingen auch viel rabiater mit Glaubensanhängern um.
Darüber müsste man reden. Es gibt das Ur-Modell und die Ausformungen und Interpretationen. Es ist ja auch interessant, dass das Modell kurzfristig wieder bei vielen Menschen Interesse weckt. Denken Sie an die Finanzkrise.
In die Nachwende-Jahre fiel auch das Engagement der Gemeinde Weißer Hirsch für das Kinderheim bei Winniza. Wie kam es dazu?
Das ehemalige Lahmann-Sanatorium wurde zu DDR-Zeiten von der Roten Armee als Lazarett genutzt. Die Bevölkerung vom WeißenHirsch litt sehr darunter, dass bei dieser Nutzung die Gebäude rapide verfielen. Nach 1990 gingen Gemeindeglieder, für mich federführend Ilona Braun, gezielt ins Sanatorium und dokumentierten den Bauzustand. Dabei entstand auch zwischenmenschlicher Kontakt zu den damaligen Nutzern, den Offizieren und Soldaten der Roten Armee. So erfuhren wir, dass die „Sieger” faktisch als „Geschlagene” in völlig ungeklärte Verhältnisse in ihre Heimat zurückkehren würden. Wir haben uns nicht bei Schadenfreude aufgehalten. Wir haben nach sinnvollen Reaktionen gesucht. Dabei stand das kirchliche Modell der Partnergemeinden Pate. Jede Kirchgemeinde im Osten hatte eine Partnergemeinde im Westen. Es ging um ideellen Austausch, von Zeit zu Zeit um materielle Hilfe. Die Kirchgemeinde Weißer Hirsch hatte mit ihrer Partnergemeinde in Hannover-Limmerein ein Gegenüber, das geradezu ideal war.
Was wir an Gutem in diesem Partnermodell erfahren hatten, wollten wir sinnvoll östlich von uns weitergeben. Als feststand, dass die Russen das Lazarett verlassen werden, haben wir einen Brief verfasst, worin sinngemäß stand, dass wir uns über die politische Entwicklung und das Ende des Kalten Krieges sehr freuen, aber konkrete Hilfe anbieten würden. Wir wären bereit, ein soziales Projekt zu unterstützen und bitten darum, diesen Brief an Krankenhäuser und soziale Einrichtungen weiterzugeben. Etwa zehn Briefe, ins Russische übersetzt, gaben wir mit und warteten Monate auf Antwort. Sie kam. Dazu wird erzählt, dass ein Soldat seinen Brief seiner Oma gab. Diese Oma kannte jemanden in einer orthodoxen Gemeinde.
Diese orthodoxe Gemeinde betreute ein Kinderheim mit etwa 300 Schülern. Ein Mitglied dieser Gemeinde reagiert mit einer behutsamen Bitte um Hilfe. Daraus entstand eine der typischen Hirsch-Aktionen. Eine Gruppe von Gemeindeglieder sagte: Da fahren wir hin! Geld und Sachen wurden gesammelt, Autos gemietet, Lebensmittel gekauft. Mitten im Winter wurde gestartet. Sie fanden die Kontaktperson und das Kinderheim. Die Kirchgemeinde unterstützte dieses Kinderheim über zehn Jahre.
Sie beschrieben am Anfang das Jahr 1988 als gutes Jahr, wo Sie sich Problemen stellten, Sie nichts verdrängten und dem Horizont ein Stück näher gekommen waren. 1989 und 1990 müssen Sie demnach den Horizont erreicht haben?
Ich glaube, es war der Tag des Anschlusses an die BRD, als ich eine Predigt mit folgender Aussage hielt: Es beginnt nicht das Paradies, aber die Verheißungen Gottes gelten weiter.