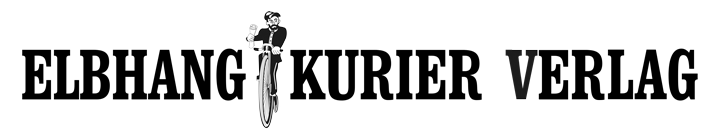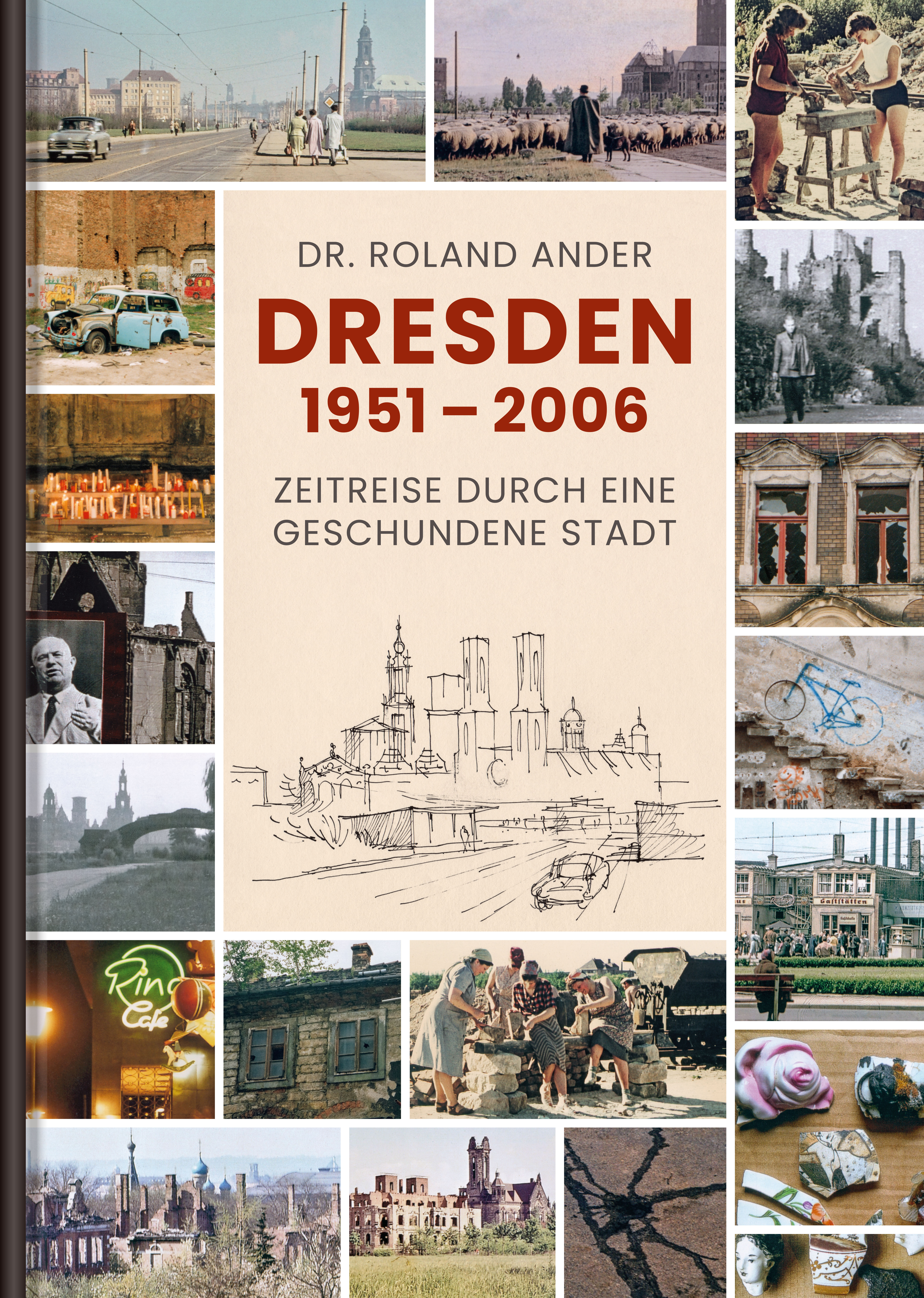Gerd Grießbach beschreibt anhand hinterlassener Briefe das Kriegsschicksal seines Großonkels Reinhold Wildenhayn (1898 – 1980), der mit dem Leben davon kam und später in Loschwitz lebte.
Das ist die Geschichte von einem 16-jährigen Dresdner Gymnasiasten, der im Oktober 1914 freiwillig mit 2789 Soldaten, Unteroffizieren und Offizieren von Dresden aus in den Krieg zog.

Reinhold Wildenhayn am 11. Oktober 1914.
Zuerst ein kleiner Geschichtsexkurs: Im August 1914 herrschten hochsommerliche Temperaturen im Deutschen Reich. Es war aber auch politisch ein heißer August, denn die Welt war seit dem Attentat von Sarajewo aus den Fugen geraten. Die Menschen in den beteiligten Staaten wurden durch Sondermeldungen, Verlautbarungen in Zeitungen und mit Plakaten auf einen notwendigen Krieg eingestimmt. Die jeweiligen Gegner wurden auf schlimme Art und Weise verteufelt, diffamiert, herabgewürdigt. Alle hielten sich für die Angegriffenen. Der Glaube an eine umfassende Einkreisung durch die Staaten der Entente machte sich in Deutschland breit, und Frankreich wollte die Schmach von 1870/71, den Verlust von Elsaß-Lothringen, ein für allemal tilgen.
In Großbritannien wurden die Deutschen bald als Hunnen bezeichnet, die man züchtigen und mit allen Mitteln bekämpfen müsste. Dabei griff man auf einen Ausspruch des deutschen Kaisers von 1900 zurück, der seinen Soldaten befohlen hatte, gnadenlos wie die Hunnen vor 1000 Jahren zu kämpfen.
Wilhelm II. und sein Kanzler, von Bethmann-Hollweg, verkündeten die Generalmobilmachung. An allen Litfaßsäulen klebte diese kaiserliche Proklamation.
Seit dem 4. August befand sich nun das Deutsche Reich im Kriegszustand mit Frankreich, Russland und Großbritannien. Der unselige Erste Weltkrieg nahm seinen Lauf. Ein schier unvorstellbarer Kriegstaumel hatte große Teile der deutschen Bevölkerung erfasst. Da enteilte der Geselle dem Meister, da verließen Studenten die Hörsäle und Seminare (mancherorts von den Professoren animiert und begleitet), da ließen Kaufleute ihre Geschäfte hinter sich, da verließen Arbeiter die Werkbänke und da bedrängten Gymnasiasten ihre Eltern, sie doch in den vaterländischen Krieg ziehen zu lassen. Die deutschen Patrioten waren sich gewiss, mit einer unschlagbaren Armee in einen kurzen Krieg zu ziehen.
Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges verwandelte die Deutschen in ein „Volk von Dichtern“. Tausende beteiligten sich an dieser poetischen Mobilmachung. Der zeitgenössische Poet F. Keil widmete die folgenden naiv-treuherzigen Verse seinem 1914 gefallenen Sohn. Der Text, hier gekürzt wiedergegeben, illustriert in einem simplen Stil die Aufbruchstimmung jener Zeit:
Sie kamen von allen Seiten…
aus jedem Haus und Stand,
sie wollten alle mitstreiten
im Kampf ums Vaterland…
Wie aber, wenn von allen
kaum einer wiederkehrt?
Fürs Vaterland gefallen
ist auch ein Leben wert.
In der Residenzstadt Dresden standen die künftigen Krieger in langen Reihen stundenlang vor dem Bezirkskommando in der Marschnerstraße, um Aufnahme in eines der neu aufgestellten Infanterie-Ersatzregimenter zu finden.
So war der 55-jährige Rektor der Meißner Fürstenschule, Prof. Dr. Poeschel, gleich mit fünf Lehrern und einer größeren Gruppe von Primanern angetreten, um mit glühendem Eifer in die sächsische Armee aufgenommen zu werden. Das ist nur eins von vielen Beispielen, wie verblendete Jünglinge, Männer und sogar Greise zu den Waffen greifen wollten, um den Erzfeind Frankreich, das perfide Albion (die britischen Inseln) und das morsche russische Reich in die Knie zu zwingen.

Fünfte Kompanie des Sächsischen Reserve-Infanterie-Regiments 241 im September 1914.
Der Weg an die Front
In diesen Kreis fügten sich zwei arglos wirkende Soldaten in schlotteriger Montur mit voller Ausrüstung auf dem Hof der Dresdner Grenadierkaserne ein. Auf den Stoffüberzügen der Pickelhauben steht die Nummer 241. Einer von ihnen war der 16-jährige Gymnasiast Reinhold Wildenhayn aus Blasewitz. Der kräftige Junge entstammte gutbürgerlichen Verhältnissen. Sein Vater war ein pensionierter deutsch-national denkender Fabrikdirektor, der einige Jahre zuvor mit einem Teil seiner Familie in Blasewitz sesshaft wurde.
Reinhold W. wuchs als Nachzügler, betreut und umhegt von seinen erwachsenen Schwestern und einer „Gesellschafterin“, in einem gediegenen Haushalt auf. Sein bereits 73-jähriger Vater erteilte ihm ohne Bedenken die Erlaubnis zum Eintritt in die Armee.
Das waren teilweise chaotische Tage, ehe diese bunt zusammengewürfelte Truppe uniformiert und voll ausgerüstet worden war. Es fehlte zunächst an Uniformen, Schuhen, Brotbeuteln und anderen notwendigen Ausrüstungsgegenständen. Aber dann empfingen sie im Arsenal ihre neuen Gewehre. Der 31. August 1914 war der Geburtstag des Königlich-Sächsischen Infanterie-Regiments 241, bei dem zwei Drittel der Mannschaften Freiwillige und die Offiziere meist ältere Herren ohne Fronterfahrungen waren.
Der Soldat Reinhold Wildenhayn wurde mit der fünften Kompanie von bärbeißigen und schnauzenden Unteroffizieren und Feldwebeln gedrillt. Untergebracht in der Dresdner Grenadierkaserne, exerzierten sie auf dem Alaunplatz, und in der Dresdner Heide wurde geschossen. Er machte mit der fünften Kompanie eine kurze und von Hektik bestimmte Ausbildung durch. Bruder Rudolf, der seit Jahren als Ingenieur in den USA lebte, schickte ihm eine aufmunternde Postkarte mit dem ausdrücklichen Wunsch, kräftig auf die Franzmänner dreinzuschlagen. In Paradeuniform trat die fünfte Kompanie zum Fotografieren an, und dann harrten die 241er ungeduldig und voller Tatendurst der Fahrt an die Front.
Am 11. Oktober wurden die 2717 Soldaten, Unteroffiziere und Offiziere auf Dresdner Bahnhöfen verladen. Mannschaften und Unteroffiziere zwängten sich in die vierte Klasse, die Offiziere reisten komfortabler. Der Marsch zu den Bahnhöfen glich einem Triumphzug. Die mit Blumen geschmückten Soldaten wurden zudem mit Liebesgaben-Paketen versorgt. Die Menschenmenge stimmte vaterländische Lieder an, es herrschte ein unvorstellbarer Jubel.
In den Abendstunden erschien dann noch der sächsische König mit seinen Töchtern auf dem Neustädter Bahnhof und verabschiedete huldvoll das III. Bataillon. Schneidig kommandierte der Herr Hauptmann… Die da auszogen, waren keine Paradesoldaten, die Kleinen kamen nicht nach, es klappte eben nicht. Lächelnd dankte der königliche Kriegsherr… (nach einem zeitgenössischen Bericht zitiert). Die Eisenbahnwagen waren mit frischem Birkengrün geschmückt. Die Kapelle spielte „Muß i denn, muß i denn zum Städtele hinaus.“ Die viertägige Eisenbahnfahrt des Regiments ging quer durch Deutschland. Von Trier folgte dann die Fahrt hinein nach Belgien. Nachts fuhr der Zug ohne Licht. Nach stundenlangen Unterbrechungen ging es dann weiter über Namur, Charleroi nach Ath, einem damals kleinen unscheinbaren Ort in Belgien. Das zuletzt kaum verpflegte Reserveregiment war im Feindesland angekommen. Die euphorische Stimmung war einem gedämpft skeptischen Optimismus gewichen.
Noch in der Nacht begann der Marsch der Bataillone auf den durchweichten Straßen Flanderns, oftmals ohne die nötige Orientierung. Da noch kein Feind zu sehen war, wurden versehentlich im Übereifer und aus Angstgefühlen heraus Personen kurzerhand als Franktireurs (frz. Freischärler/Partisan) verdächtigt und manchmal auch exekutiert.
Bis zum 20. Oktober marschierte das Regiment gegen den Feind, hatte schließlich seine „Feuertaufe“, dabei erhebliche Verluste und zudem Ausfälle durch fußkranke und total erschöpfte Soldaten, die den physischen Belastungen kaum gewachsen waren. Die Bataillone des 241. Reserve-Infanterie-Regiments standen englisch-französischen und belgischen Heeresverbänden gegenüber, konnten sich trotz gewaltiger Verluste kurze Zeit behaupten, mussten sich aber bald eingraben, um vor den Schrapnells und dem Maschinengewehrfeuer sicherer zu sein. Die Front war bereits aufgerissen, es gab keinen Flankenschutz mehr. Die Bataillone waren schnell auf Kompaniestärke geschrumpft. Reserven gab es nicht. Der Regimentskommandeur, Oberst Graul, gab in dieser fast aussichtslosen Lage den Rückzugsbefehl. Das blutige Ringen um Ypern (besser: das „sinnentleerte Sterben“) war für die 241er vorerst zu Ende.
Ein Zeitgenosse, er war Soldat des 241. Reserve-Infanterie Regiments, berichtete:
„…2 Offiziere und 120 Mann vom Regiment 241 trafen am 19. November in den frühen Morgenstunden im Ruhequartier ein. Das war der Rest des stolzen Regiments, das vier Wochen vorher mit einer Gefechtsstärke von 72 Offizieren und 2717 Unteroffizieren und Mannschaften in den Kampf gezogen war.“
Überleben in französischer Gefangenschaft
Reinhold Wildenhayn gehörte nicht zu diesem Rest. Er geriet in den nachfolgenden Kämpfen im Dezember 1914 unversehens und unverletzt in französische Gefangenschaft. Ein anderer Teil des Regiments wurde von englischen Truppen gefangen genommen und auf die britische Insel nach Leeds gebracht. Die Heeresberichte dokumentierten zwar die Verluste, einschließlich der Vermissten, aber über in Gefangenschaft geratene Soldaten gab es wenig Informationen.
Er hatte überlebt, und es war eigentlich ein glücklicher Umstand, dass der mangelhaft ausgebildete Schülersoldat, ohne den furchtbaren Grabenkrieg in Flandern mitgemacht zu haben, nun einen weniger lebensgefährlichen Tagesablauf durchlebte. Jetzt ist er der Kriegsgefangene mit der Nummer 11.010. Aber er ist mit knapp siebzehn Jahren von jeglicher persönlichen Entwicklung abgeschnitten. Er muss sich als PG (Prisonnier de Guerre/Kriegsgefangener) gekennzeichnet, mit einem Leben hinter dem Stacheldraht einrichten. Die Jahre bis 1919 sind für den Heranwachsenden voller Entbehrungen, enttäuschter Hoffnungen und nagender Ungewissheit über seine Zukunft. Im Juni 1915 hatte sich der sächsische König gewogen gefunden, dem Kriegsgefangenen Reinhold Wildenhayn die Friedrich-August-Medaille in Bronze mit dem Bande für Kriegsdienste zu verleihen; eine Farce – diese Auszeichnung diente der Kriegspropaganda, denn der Ausgezeichnete hat sie nicht persönlich in Empfang nehmen können.
(Fortsetzung folgt – siehe Elbhang-Kurier September 2014)
Gerd Grießbach